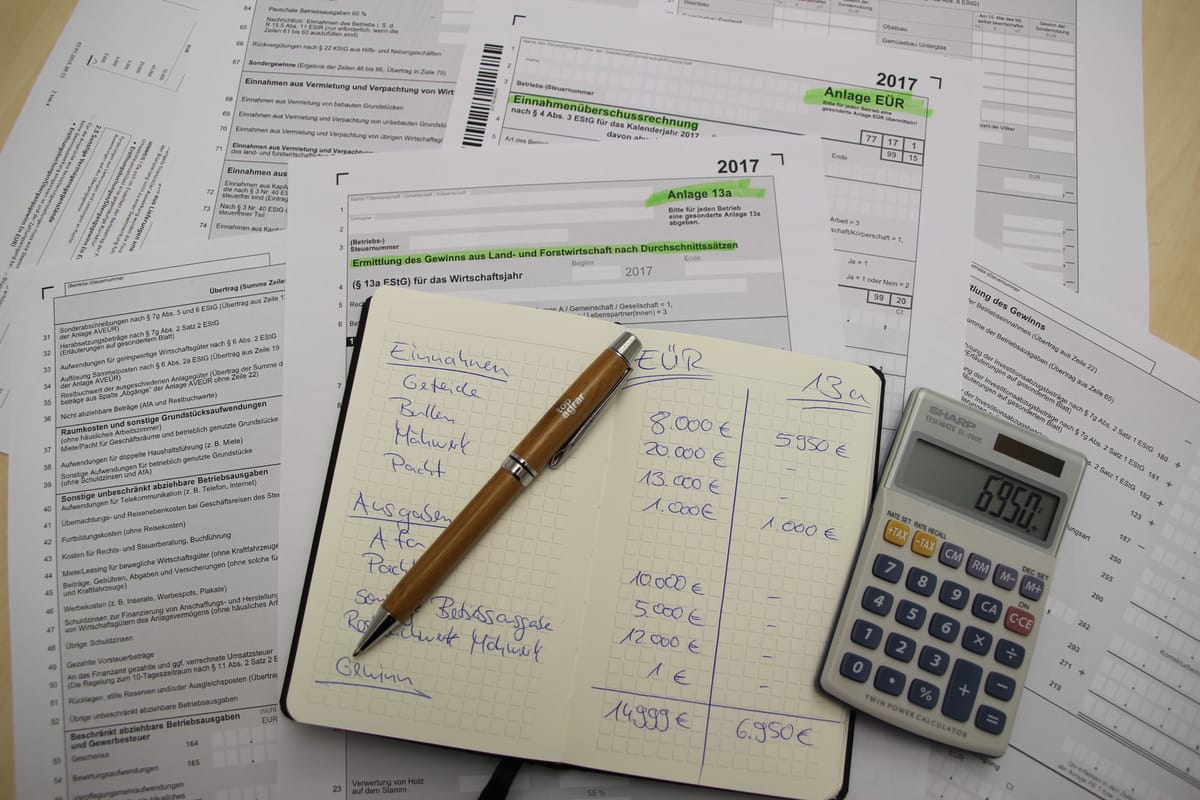1.436 Tonnen Vertrauen
Rund 270.000 Goldbarren besitzt die Bundesrepublik Deutschland – das entspricht etwa 3.370 Tonnen Feingold. Ein Drittel davon, konkret 1.236 Tonnen, liegt nicht in deutschen Tresoren, sondern in ausländischer Verwahrung: hauptsächlich in New York, ein kleinerer Teil in London.
Das meiste davon – rund 37 % – ruht im Keller der Federal Reserve Bank of New York.
Diese Zahl war lange ein Symbol für Deutschlands globale Verflechtung. Heute wirkt sie eher wie ein Risiko. Denn was einst als logistische Vorsorge für den Ernstfall galt – ein schneller Zugriff auf US-Dollar über physisch eingelagertes Gold – wird nun zur strategischen Schwachstelle.
Trumps Rückkehr verändert die Lage
Mit der erneuten Präsidentschaft von Donald Trump und dem wachsenden politischen Einfluss von Tech-Milliardär Elon Musk verschieben sich die Koordinaten der US-Politik.
Beide haben öffentlich Zweifel an der Buchhaltung der eigenen Goldreserven geäußert. Aussagen, die aus deutscher Perspektive höchst problematisch sind – nicht nur, weil sie Unsicherheit streuen, sondern weil sie implizit auch Fragen nach der Verlässlichkeit der US-Goldverwahrung aufwerfen.
Wenn Washington selbst nicht sicher ist, wie viel Gold in Fort Knox liegt – wie sicher ist dann deutsches Gold in derselben Obhut?
Heimholen, prüfen, sichern
Die Forderung ist nicht neu – aber sie hat neues Gewicht. CDU-Politiker Marco Wanderwitz forderte bereits 2012 Einsicht in die Lagerbestände der Bundesbank. Damals blieb der Zugang zu den US-Tresoren eingeschränkt, eine vollständige Prüfung wurde verweigert. Jetzt, mit einer instabiler werdenden Weltordnung, scheint das Thema wieder oben auf der Agenda zu stehen.
Michael Jäger vom Europäischen Steuerzahlerbund bringt es auf den Punkt:
„Das deutsche Gold gehört nach Hause – sofort.“
Er fordert nicht nur Rückführung, sondern physische Prüfung: nicht Sichtkontrolle, sondern Wiegen, Zählen, Dokumentieren.
Auch Markus Ferber (CSU) warnt: Vertrauen sei gut, Kontrolle besser – besonders dann, wenn die politische Lage eine Eskalation zwischen Partnern nicht mehr ausschließt.

Die Bundesbank beschwichtigt
Frankfurt hingegen bleibt betont gelassen. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel erklärte im Februar, das Vertrauen in die Federal Reserve sei ungebrochen. Man schlafe ruhig, man kenne die Verfahren, man sehe keinen Grund zur Sorge. Die Notenbank verweist auf den zwischenstaatlichen Charakter der Verwahrung und die bestehenden bilateralen Verträge mit der US-Zentralbank.
Doch die Geschichte hat gezeigt: Politisches Vertrauen ist eine flüchtige Währung – und spätestens seit 2014, als ein Teil der Goldreserven nach Frankfurt zurückgeführt wurde, weiß man, dass Repatriierung möglich ist – wenn auch logistischer Aufwand und politischer Wille stimmen.
Ein Drittel in fremder Hand – immer noch
Zwischen 2013 und 2017 brachte die Bundesbank bereits rund 674 Tonnen Gold aus New York und Paris zurück nach Frankfurt – ein Kraftakt, verteilt über Jahre, mit öffentlichkeitswirksamer Transparenz. Doch warum wurde die Rückführung dann nicht vollständig vollzogen?
Die Antwort lautet: strategisches Kalkül. Damals galten die USA als verlässlicher Partner, der geopolitische Druck war geringer, die Finanzsysteme enger verflochten. 2025 aber sieht das Bild anders aus: Handelskonflikte, autokratische Tendenzen, militärische Unruhe, Entdollarisierungstendenzen – all das stellt die Frage neu, ob Deutschlands Währungsreserven auf sicherem Boden stehen.
Was, wenn Washington blockiert?
Ein oft übersehenes Risiko: Im Fall eines diplomatischen Zerwürfnisses oder wirtschaftspolitischer Sanktionen könnten ausländisch gelagerte Reserven eingefroren werden – siehe Russland. Auch wenn die Situation kaum vergleichbar ist, zeigt sie doch: Was nicht im Inland lagert, steht im Ernstfall nicht zweifelsfrei zur Verfügung.
Die USA sind kein Gegner, aber sie sind auch kein neutraler Dienstleister. Dass Goldreserven unter amerikanischem Recht und in amerikanischen Tresoren liegen, ist heute mehr Risiko als Vorteil.
Das könnte Sie auch interessieren: