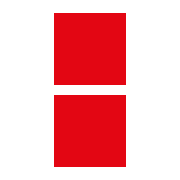Drehen an der Verlustschraube
Wer glaubt, der Handel mit Turbo-Zertifikaten sei ein kalkulierbares Spiel mit der Kursbewegung, irrt – und das im großen Stil.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat in einer umfassenden Marktstudie für die Jahre 2019 bis 2023 festgestellt: Drei von vier Privatanlegern verlieren beim Handel mit diesen hochspekulativen Hebelprodukten – und zwar im Schnitt 6.400 Euro pro Person. Der Gesamtschaden? 3,4 Milliarden Euro.
Die Konsequenz: Die Bafin verschärft die Regeln – deutlich, aber ohne das Instrument vollständig zu verbieten.
Kaufen, hoffen, verlieren
Der Grund für die massiven Verluste ist strukturell: Turbo-Zertifikate gehören zu den sogenannten Hebelprodukten. Sie erlauben es Anlegern, mit geringem Kapitaleinsatz überproportional auf Kursbewegungen zu wetten – nach oben wie nach unten. Was wie eine Einladung zum schnellen Geld klingt, ist in der Realität für viele Kleinanleger ein Türöffner ins Minus.
Laut Bafin werden rund 70 % der Produkte weniger als einen Tag gehalten. Je häufiger die Kunden handeln, desto schlechter fällt die Bilanz aus: Wer mehr als 1.000 Trades in einem Jahr tätigt, verliert mit einer Wahrscheinlichkeit von 91 % Geld. Ein toxisches Verhältnis aus kurzfristiger Spekulation, fehlendem Wissen und algorithmischem Overtrading.
Drei Maßnahmen – ein Signal
Mit drei neuen Regeln will die Bafin die Notbremse ziehen:
- Warnpflicht mit Klartext
Anbieter müssen künftig deutlich sichtbare Risikohinweise geben – inklusive der statistischen Verlustwahrscheinlichkeit für Kleinanleger. Marketingfloskeln haben dort nichts mehr zu suchen. - Wissenstest für Einsteiger und Fortgeschrittene
Wer Turbos handeln will, muss einen Test mit mindestens sechs korrekt beantworteten Fragen bestehen – und das alle sechs Monate aufs Neue. Ein simpler Klick auf „verstanden“ genügt künftig nicht mehr. - Verbot von Kaufanreizen
Cashbacks, Bonusaktionen oder Rabatte beim Handel mit Turbos werden untersagt. Damit soll verhindert werden, dass Anreize zum übermäßigen Handeln führen – unabhängig von der individuellen Risikoeignung.
Kein Verbot – aber ein klarer Kurswechsel
Ein vollständiges Verbot der Produkte lehnt die Bafin ab. Der Grund: Es gäbe auch erfahrene Anleger, die Turbos gezielt einsetzen. Ein Pauschalverbot wäre unverhältnismäßig. Stattdessen setzt die Behörde auf Transparenz, Information und Regulierung durch Auflagen – und ruft betroffene Anbieter dazu auf, bis 3. Juli Stellung zu beziehen.
Das zeigt: Die Aufsicht will nicht alles verbieten – aber vieles verändern. Gerade in einem schrumpfenden Markt, der aktuell etwa 10 % unter dem Vorjahresniveau liegt, ist das ein sensibles Signal.
Ein Markt in wenigen Händen
Der deutsche Zertifikatemarkt wird von wenigen dominiert: Fünf Anbieter halten rund drei Viertel des Geschäfts mit Turbo-Zertifikaten. Die Mehrheit von ihnen sind Töchter ausländischer Finanzkonzerne. Sparkassen und viele Genossenschaftsbanken bieten die Produkte bewusst nicht an – ein Umstand, der nun als weitsichtig erscheint.
Denn was als innovatives Derivat begann, ist heute vielfach ein Verlustmultiplikator – für Privatanleger, nicht für Anbieter. Letztere verdienen an jeder Order, egal wie sie ausgeht. Daran wird auch die neue Regulierung wenig ändern – wohl aber am Informationsstand und an der Einstiegshürde für potenzielle Käufer.
Die neue Grenze zwischen Rendite und Roulette
Mit den geplanten Maßnahmen positioniert sich die Bafin klarer als bislang: Der private Derivathandel darf nicht länger auf Einsteigerfreundlichkeit machen, wenn er statistisch in Verluste führt. Was die Aufsicht nicht ausspricht, aber signalisiert: Turbo-Zertifikate sind nichts für Hobby-Anleger – und das sollten sie auch nie gewesen sein.
Das könnte Sie auch interessieren: