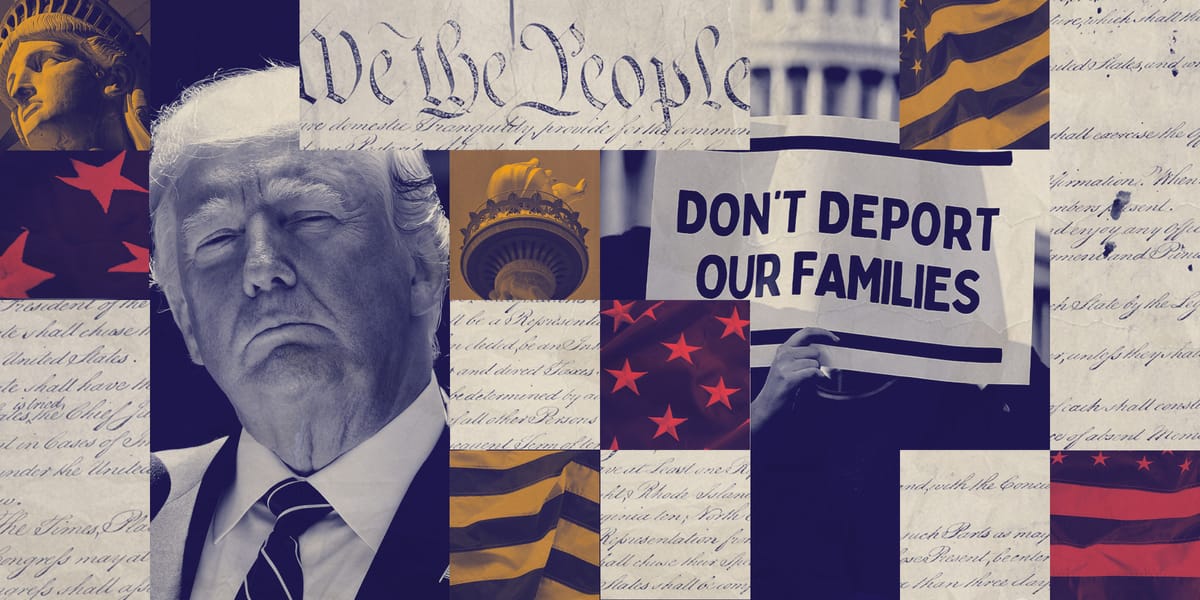Zölle als Waffe, Verlässlichkeit als Opfer
Donald Trump hat einen neuen Feiertag erfunden: den „Liberation Day“. Am 2. April sollen Strafzölle gegen den Rest der Welt in Kraft treten – reziprok, wie der Präsident sagt. Gemeint ist: Vergeltung für jeden, der es wagt, die USA schlechter zu behandeln als andere. Was wie ein PR-Gag klingt, ist bitterer Ernst. Bereits jetzt sind neue Sonderzölle auf Autoimporte angekündigt, mit bis zu 25 Prozent in der Spitze.
Wer dachte, Trump würde aus seiner ersten Amtszeit lernen, liegt falsch. Er führt genau jene Politik fort, die Handelspartner vergrault, Unternehmen verunsichert und die Regeln des freien Welthandels untergräbt. Das Signal: Amerika ist nicht mehr berechenbar. Und das wirkt – nicht nur außenpolitisch, sondern auch ökonomisch.
Protektionismus frisst Wachstum
Dass Trumps Zollpolitik nicht nur den Handel belastet, sondern direkt den US-Konsumenten trifft, ist längst belegt. Laut dem Peterson Institute for International Economics kostet sein Maßnahmenpaket einen durchschnittlichen US-Haushalt jährlich bis zu 2.600 Dollar – nur durch teurere Importe.
Die Idee, dass sich durch Zölle heimische Produktion wiederbeleben lässt, ist ökonomisch naiv. Die meisten Unternehmen arbeiten heute entlang globaler Lieferketten. Wer diese zerschlägt, zerstört nicht nur Effizienz, sondern auch Vertrauen.
Schulden ohne Plan
Parallel zur handelspolitischen Eskalation fährt Trump eine Haushaltspolitik, die den Staatshaushalt der USA an den Rand des Machbaren bringt. Die Schuldenquote liegt bereits über 120 Prozent der Wirtschaftsleistung, Tendenz steigend. Noch nie war die Zinslast höher: In diesem Jahr zahlen die USA erstmals mehr für Zinsen als für Verteidigung.
Steuersenkungen auf Pump, milliardenschwere Subventionen, dazu neue Militärausgaben – die Rechnung überlässt Trump lieber anderen. Doch die Kapitalmärkte beginnen bereits zu reagieren. Das Vertrauen in die langfristige Stabilität der US-Staatsfinanzen bröckelt. Und wenn dieses Vertrauen schwindet, wackelt das Fundament des Dollars.
Die Notenbank als Feindbild
Trumps Verhältnis zur US-Zentralbank ist angespannt – milde formuliert. In Wahrheit scheint er entschlossen, die Federal Reserve politisch zu dominieren. Schon 2019 hatte er versucht, Notenbankchef Jerome Powell öffentlich zu diskreditieren. Jetzt, da dessen Amtszeit bald endet, will Trump einen Gefolgsmann installieren.
Warum? Weil er niedrige Zinsen braucht. Nicht für die Wirtschaft, sondern für seine Schuldenpolitik. Dass steigende Zinsen derzeit angesichts hoher Inflation ökonomisch sinnvoll wären, stört ihn nicht. Im Gegenteil: Trump droht der Fed – ein Tabubruch mit potenziell weltweiten Folgen.
Denn sollte sich die Unabhängigkeit der Fed auflösen, wäre das Vertrauen in den Dollar als Leitwährung massiv beschädigt. In einer Welt, die nach Stabilität sucht, wäre das ein Erdbeben.

Dollar-Diplomatie: Schutz gegen Anleihekauf?
Ein besonders perfider Teil der Trumpschen Agenda: die Idee, andere Staaten indirekt zum Kauf amerikanischer Anleihen zu zwingen. Angeblich wird in Washington bereits über eine Art „Mar-a-Lago Accord“ nachgedacht – wer US-Staatsanleihen zeichnet, soll im Gegenzug militärischen Schutz bekommen. Wer sich verweigert, riskiert das Gegenteil.
Das erinnert eher an Schutzgelderpressung als an globale Finanzpolitik. Und es setzt das internationale Vertrauen in die USA erneut aufs Spiel. Wer langfristige Anleihen eines Landes hält, das seine Partner öffentlich unter Druck setzt, wird sich beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob er das Investment wiederholt.
Trumponomics: Eine Strategie der Instabilität
Was Trump betreibt, ist keine kohärente Wirtschaftspolitik. Es ist eine lose Sammlung von Maßnahmen, getrieben von Machtdemonstration, nationalistischem Reflex und Misstrauen gegenüber Institutionen. Das Problem: Die USA sind nicht nur irgendein Land. Sie sind bis heute der Anker der globalen Finanzarchitektur – mit dem Dollar als Leitwährung, mit US-Staatsanleihen als sicherster Anlage der Welt, mit Kapitalmärkten, die weltweite Investitionsströme steuern.
Wenn diese Rolle beschädigt wird – sei es durch ein Schuldenchaos, durch politische Einflussnahme auf die Fed oder durch aggressiven Protektionismus –, dann betrifft das nicht nur Amerika. Es betrifft alle.
Das könnte Sie auch interessieren: