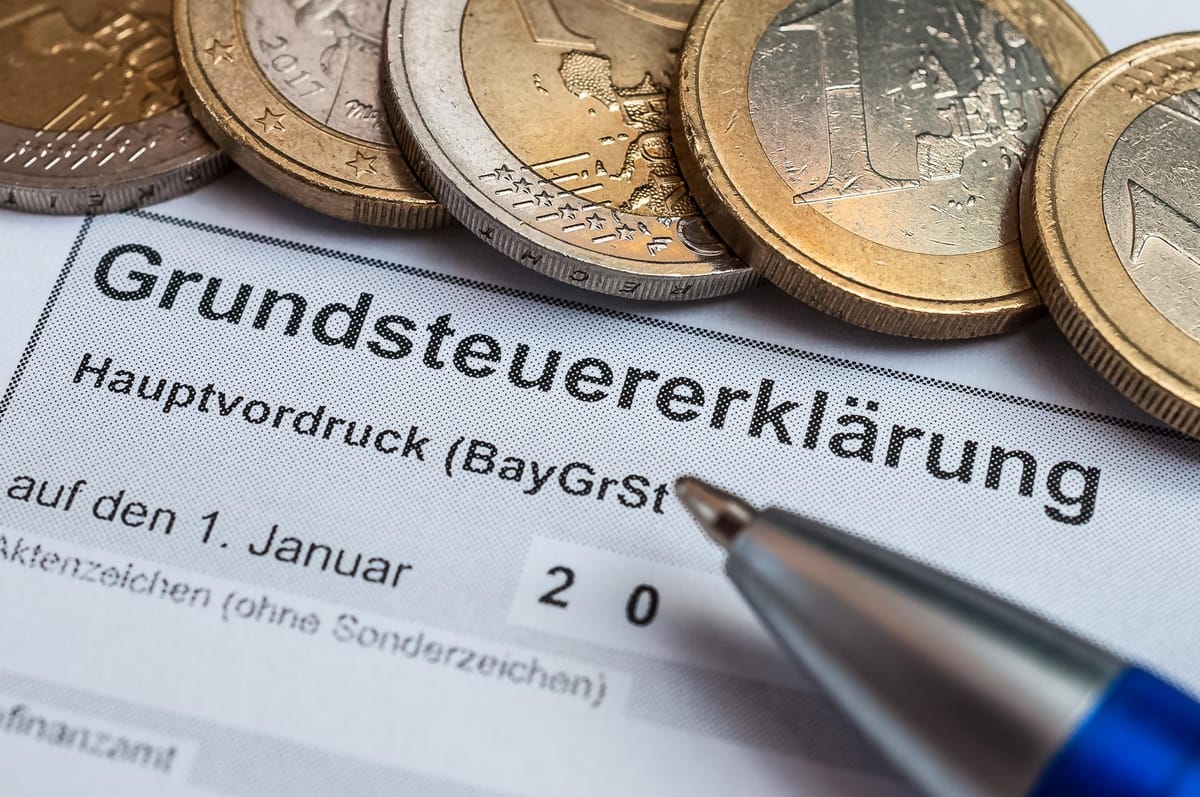Wenn neutral plötzlich teuer wird
Für viele Berliner Eigenheimbesitzer war der Blick in den Briefkasten Ende 2024 ein Schock. Statt der gewohnten 273 Euro sollte das Einfamilienhaus am Stadtrand künftig 913 Euro kosten.
Eine Wohnung im Altbau in Mitte sprang gar von 136 auf 950 Euro – ein Plus von fast 600 Prozent. Und das, obwohl die Politik 2019 versprach, es werde mit der Reform „nicht teurer“. Was ist da passiert?
Aufkommensneutral? Ja – aber nicht für jeden
Was wie ein Widerspruch klingt, ist in der Logik des Bundesmodells erklärbar: Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer sollte gleich bleiben. Also: Die Stadt Berlin nimmt nicht mehr ein als zuvor – zumindest nicht viel.
Doch das bedeutet nicht, dass jeder Einzelne auch gleich viel zahlt. Wer früher zu wenig bezahlt hat, zahlt nun mehr. Wer früher zu viel gezahlt hat, wird entlastet. Der politische Haken: Die „Gewinner“ schweigen meist – die „Verlierer“ schreien laut.
Friedrichshain zahlt mehr, Spandau weniger
Die jetzt vorgelegten Zahlen zeigen, wie stark die Umverteilung innerhalb Berlins ausfällt. In Szenebezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg steigt die durchschnittliche Steuer um knapp 40 Prozent, ebenso in Prenzlauer Berg.

In Westbezirken wie Spandau oder Reinickendorf hingegen sinkt sie um über ein Drittel. Grund ist der Bodenrichtwert: Die Einheitswerte aus 1935 (Ost) und 1964 (West) wurden durch aktuelle Immobilienbewertungen ersetzt – mit spürbaren Folgen.
Komplexität statt Klarheit
Berlin folgt – wie zehn andere Bundesländer – dem Bundesmodell. Das heißt: Bewertet wird nach einem Mix aus Bodenwert, Baujahr, Wohnfläche, fiktiver Miete und Nutzung. Andere Länder wie Bayern oder Baden-Württemberg haben eigene Modelle eingeführt.
Einfacher ist das Bundesmodell dadurch nicht. Im Gegenteil: Selbst Fachleute tun sich schwer, die exakte Berechnung zu durchdringen. Für viele Bürger bleibt die neue Grundsteuer ein Buch mit sieben Siegeln.
Wem gehört Berlin – und was ist es der Stadt wert?
Auch politisch ist das Thema geladen. Die Reform offenbart implizit, was die Stadt über Wert und Nutzung ihrer Flächen denkt. Eigentümer von Einfamilienhäusern zahlen jetzt teils deutlich mehr, da für alle Wohnimmobilien der gleiche Steuermultiplikator gilt.
Die frühere Begünstigung von Ein- und Zweifamilienhäusern ist Geschichte. Damit reagiert Berlin nicht nur auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts – sondern setzt auch eigene Akzente in der Stadtentwicklung.
Bauen hilft – oder auch nicht
Ein weiterer Faktor: Neubauten treiben die Einnahmen. Gerade im Osten Berlins wurde seit 2000 stark gebaut – was zu höheren Steuerschätzungen führt. Denn jüngere Gebäude erhöhen den steuerlichen Wert.
Wo hingegen ältere Bestände dominieren, wie in vielen Westbezirken, fällt die neue Belastung geringer aus. Es ist eine geografische Verschiebung mit klaren finanziellen Auswirkungen.
Das große Missverständnis
Finanzsenator Stefan Evers verteidigt die Reform: Das Gesamtaufkommen sei nahezu identisch mit dem Vorjahr – also sei das Versprechen der Aufkommensneutralität erfüllt.
Tatsächlich lag das Aufkommen im Februar 2025 mit 173 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert. Doch das greift zu kurz. Denn was Bürger wirklich interessiert, ist nicht die Systemlogik, sondern der eigene Kontostand. Und da hilft ein Prozent mehr oder weniger im Stadthaushalt wenig, wenn die eigene Rechnung sich verdreifacht.
Was jetzt auf dem Spiel steht
Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Die neue Grundsteuer wird in den kommenden Jahren auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüft. Verfahren sind anhängig – bis hinauf zu den obersten Gerichten. Sollte eines der Modelle durchfallen, droht die nächste Reform.
Schon jetzt mehren sich Stimmen, die eine Evaluierung fordern. Berlin wartet auf Erfahrungsberichte aus anderen Bundesländern – insbesondere von jenen, die sich bewusst gegen das Bundesmodell entschieden haben.
Das könnte Sie auch interessieren: