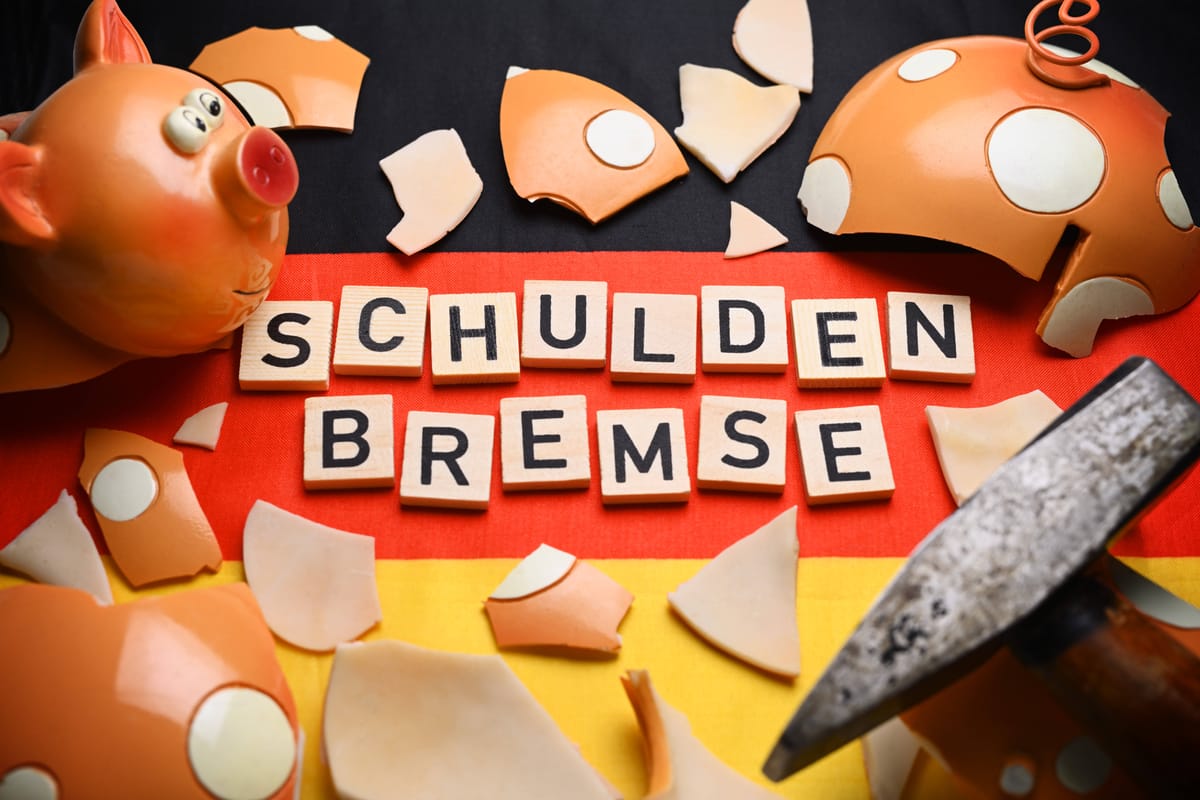Die Schuldenbremse, so klang es oft aus dem Kanzleramt, habe die Ampel-Regierung an größeren wirtschaftlichen Erfolgen gehindert. Doch ein Blick auf die Zahlen zeichnet ein anderes Bild: Seit Amtsantritt von Olaf Scholz im Dezember 2021 ist die Verschuldung des Bundes um 253 Milliarden Euro gestiegen – trotz des Verfassungsgerichtsurteils, das geplante Umschichtungen verhinderte.
Woher kommen die neuen Schulden?
Zum Jahresende 2024 betrugen die Schulden des Bundes laut Finanzagentur 1691 Milliarden Euro. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass die Ampel-Koalition in nur drei Jahren fast so viele neue Schulden aufgenommen hat wie die Große Koalition in den vier Jahren zuvor.
Ein erheblicher Teil der Neuverschuldung geht auf die Krisen der vergangenen Jahre zurück. Während Scholz als Finanzminister die Corona-Pandemie mit massiven Hilfsprogrammen bekämpfte, kamen als Kanzler weitere Belastungen hinzu: der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, steigende Energiepreise und ein drohender wirtschaftlicher Abschwung.
Doch nicht alle Schulden wurden für Krisenmaßnahmen aufgenommen. Das Sondervermögen für die Bundeswehr, ursprünglich mit 100 Milliarden Euro geplant, hat bislang nur 23 Milliarden Euro tatsächlich in Rüstungsausgaben gelenkt.
Auch der „Doppelwumms“ zur Dämpfung der Energiepreise wurde weit weniger in Anspruch genommen als zunächst angekündigt: Von den möglichen 200 Milliarden Euro wurden letztlich nur 72 Milliarden genutzt.
Schulden trotz Schuldenbremse – ein Widerspruch?
Die Schuldenbremse sollte genau solche Entwicklungen eigentlich verhindern. Doch die Ampel fand Mittel und Wege, sie zu umgehen. So wurden Schulden in Sondervermögen und Nebenhaushalte ausgelagert – ein juristischer Kniff, den das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr stoppte.
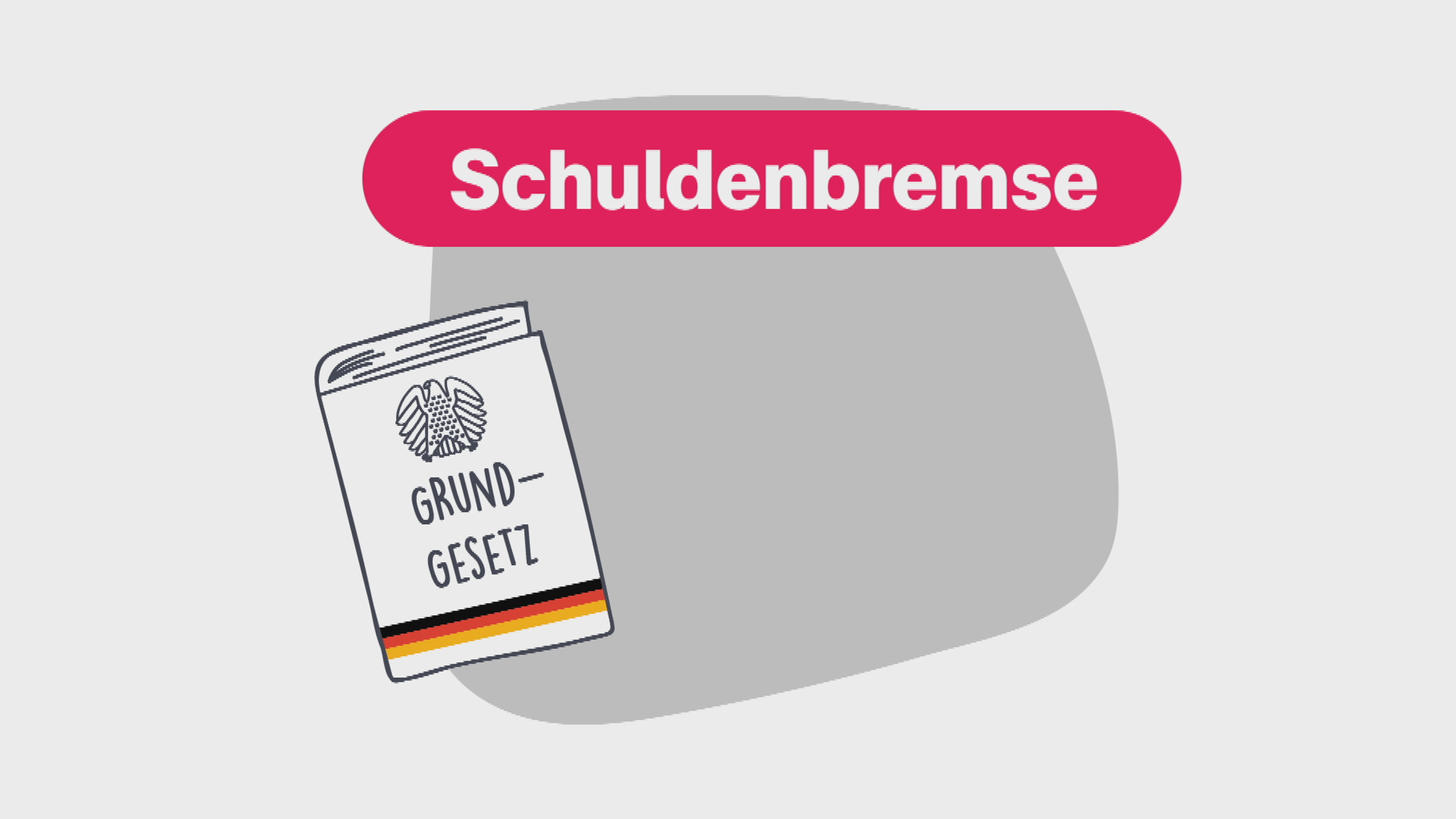
Die Richter erklärten die Umschichtung ungenutzter Corona-Kredite für den Klimafonds für nichtig und zwangen die Regierung, 60 Milliarden Euro aus dem Haushaltsplan zu streichen.
Wirtschaftsexperten sehen darin ein systemisches Problem: „Die Schuldenbremse ist ein zahnloser Tiger, wenn sich Regierungen über Nebenhaushalte neue Finanzspielräume schaffen“, sagt ein Ökonom aus dem ifo-Institut. „Wenn sie ernsthaft eingehalten werden soll, braucht es klare Regeln für Kreditaufnahmen in Krisenzeiten.“
Wie viel Staat kann sich Deutschland leisten?
Trotz der massiven Schuldenaufnahme gibt es auch positive Entwicklungen. Die gesamtstaatliche Schuldenquote – also das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung – ist seit 2021 von 69 auf knapp 64 Prozent gesunken.
Das liegt jedoch weniger an der Haushaltsdisziplin, sondern daran, dass die Inflation und die wirtschaftliche Erholung das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wachsen ließen.
Der Bundeshaushalt selbst blieb hingegen auf einem hohen Ausgabenniveau. 2024 gab der Bund 466 Milliarden Euro aus – das entspricht 10,8 Prozent des BIP. Im letzten krisenfreien Jahr 2019 lag die Quote noch bei 10,0 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das: Der Bund hätte 2024 rund 35 Milliarden Euro weniger ausgeben müssen, um auf das Vorkrisenniveau zurückzukehren.
Investitionen oder Konsum – wohin floss das Geld?
Die Ampel hat zwar die Investitionen auf ein Rekordniveau von 57 Milliarden Euro gesteigert, doch der Anteil an den Gesamtausgaben bleibt bescheiden. 2024 lag der Investitionsanteil bei 12 Prozent, während 88 Prozent für konsumtive Ausgaben wie Sozialleistungen und Personalkosten verwendet wurden. 2019 lag das Verhältnis bei 11 zu 89 Prozent – eine Verbesserung, aber keine Revolution.
Das könnte Sie auch interessieren: