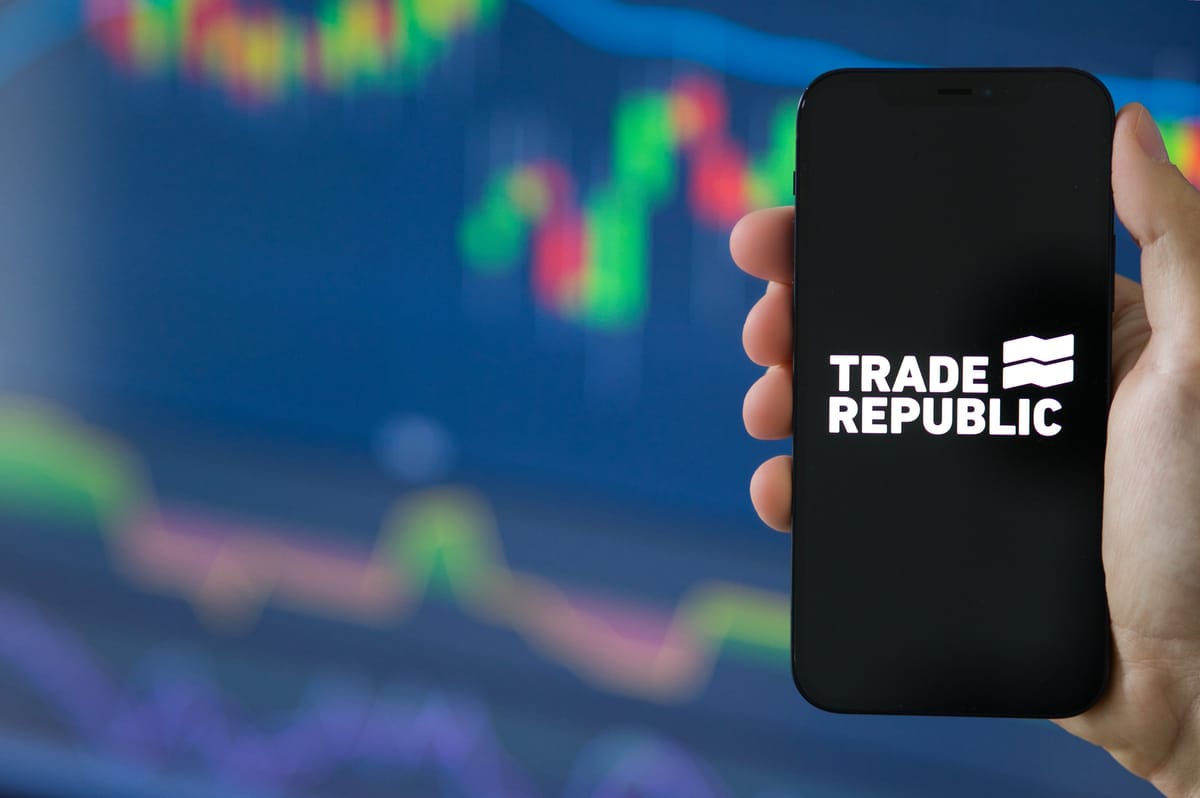System am Limit – ausgerechnet, wenn’s drauf ankommt
Montagmorgen, Börsenbeben, App-Ausfall. Während Anleger hektisch auf fallende Kurse reagieren, geht bei Trade Republic zeitweise nichts mehr. Charts laden nicht, Orders hängen fest, Depots frieren ein.
Auf dem Portal „Alle Störungen“ türmen sich die Beschwerden – viele tausend Nutzer melden sich fast zeitgleich.
Die Ursache ist schnell gefunden: Überlastung. Zu viele Zugriffe auf einmal, zu wenig Puffer im System. Dass sich die Berliner Trading-App ausgerechnet in einem so sensiblen Moment aufhängt, dürfte Christian Hecker, Mitgründer und CEO von Trade Republic, nervös gemacht haben.
Nicht nur, weil es dem Image schadet, sondern weil es zeigt, wie fragil das Fundament noch ist – und was da auf ihn zukommt.
Das Ende eines lukrativen Geschäftsmodells
Denn der eigentliche Sturm zieht erst noch auf. Ab Januar 2026 greift das EU-weite Verbot sogenannter „Payment for Order Flow“-Modelle.
Bislang kassiert Trade Republic für jede Order, die an Handelspartner wie Lang & Schwarz weitergeleitet wird, eine kleine Vergütung. Für den Nutzer fällt keine Provision an – für den Broker aber eine stabile Einnahmequelle.

Diese Praxis wird in zwei Jahren untersagt. Und damit steht das Grundprinzip vieler Neobroker auf der Kippe. Kein Wunder also, dass Hecker laut Insidern intensiv an Alternativen tüftelt. Die naheliegendste: den Handel selbst in die Hand nehmen.
Market-Maker in Eigenregie – Ein riskanter Schritt
Konkret prüft Trade Republic die Entwicklung eines eigenen Market-Makers. Ein Baustein, den etwa Scalable Capital bereits in sein System integriert hat. Die Idee: Kurse nicht nur anzeigen, sondern selbst stellen.
Also: als Gegenpartei auftreten, Käufe und Verkäufe aus dem eigenen Bestand bedienen – und damit die Abhängigkeit von Drittanbietern reduzieren.
Das klingt technisch, hat aber tiefgreifende Konsequenzen. Ein Market-Maker braucht Kapital, Technologie, Personal – und Vertrauen. Denn wenn ein Broker gleichzeitig als Handelsplatz und als Gegenpartei agiert, ist die Grenze zwischen Service und Interessenkonflikt schnell erreicht.
Technologie allein reicht nicht – Vertrauen wird zur Währung
Hecker weiß das. Und doch scheint ihm klar: Wenn Trade Republic überleben will, muss das Unternehmen mehr als nur eine App sein. Die neue Strategie lautet offenbar: vertikale Integration.
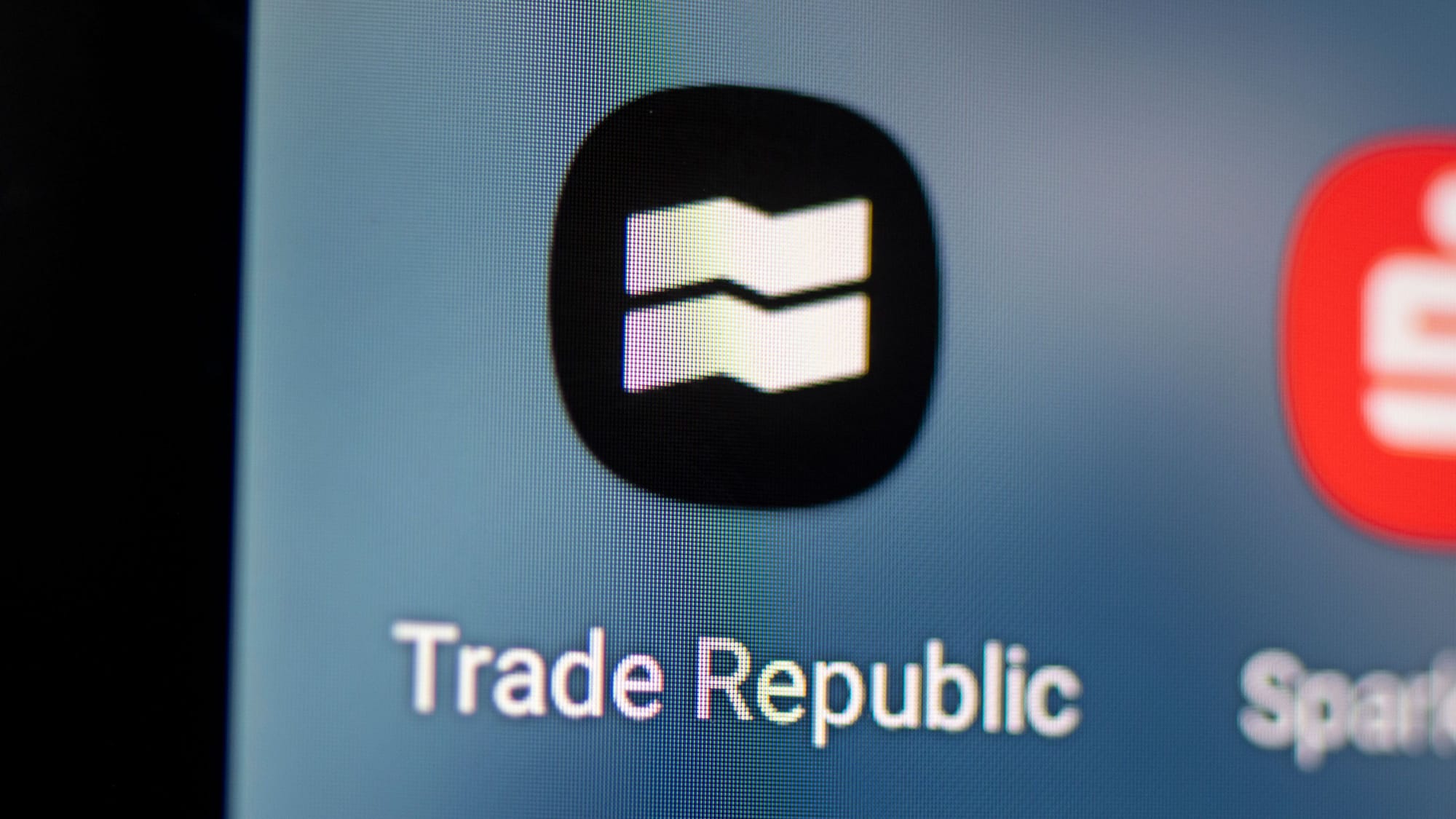
Nicht nur weiterleiten, sondern selbst handeln. Nicht nur die Oberfläche, sondern die Infrastruktur. Doch das bedeutet auch: volle Verantwortung für Liquidität, Kursqualität – und im Zweifel für technische Ausfälle wie am Montagmorgen.
Die Konkurrenz bleibt derweil nicht stumm. Upvest-Chef Martin Kassing – verantwortlich für den Handelspartner von N26 – nutzte die Schwäche von Trade Republic für einen Seitenhieb auf LinkedIn: „Keine Störungen bei unserer Schnittstelle“, postete er – samt Jobangeboten.
Die Balance zwischen Wachstum und Stabilität wird zur Kernfrage
Mit rund einer Million aktiven Nutzern allein in Deutschland ist Trade Republic längst kein kleines Start-up mehr. Doch das System hinter dem Frontend wirkt stellenweise noch wie ein Provisorium – schnell skaliert, nicht immer stabil. Und nun steht das Unternehmen vor einem tiefgreifenden Umbau, der zugleich regulatorisch, technisch und strategisch anspruchsvoll ist.
Wie dieser Wandel gelingt – ob mit eigenem Market-Maker oder anderen Lösungen – wird entscheidend dafür sein, ob der Berliner Broker die nächste Phase seines Wachstums überhaupt erreicht.
Das könnte Sie auch interessieren: