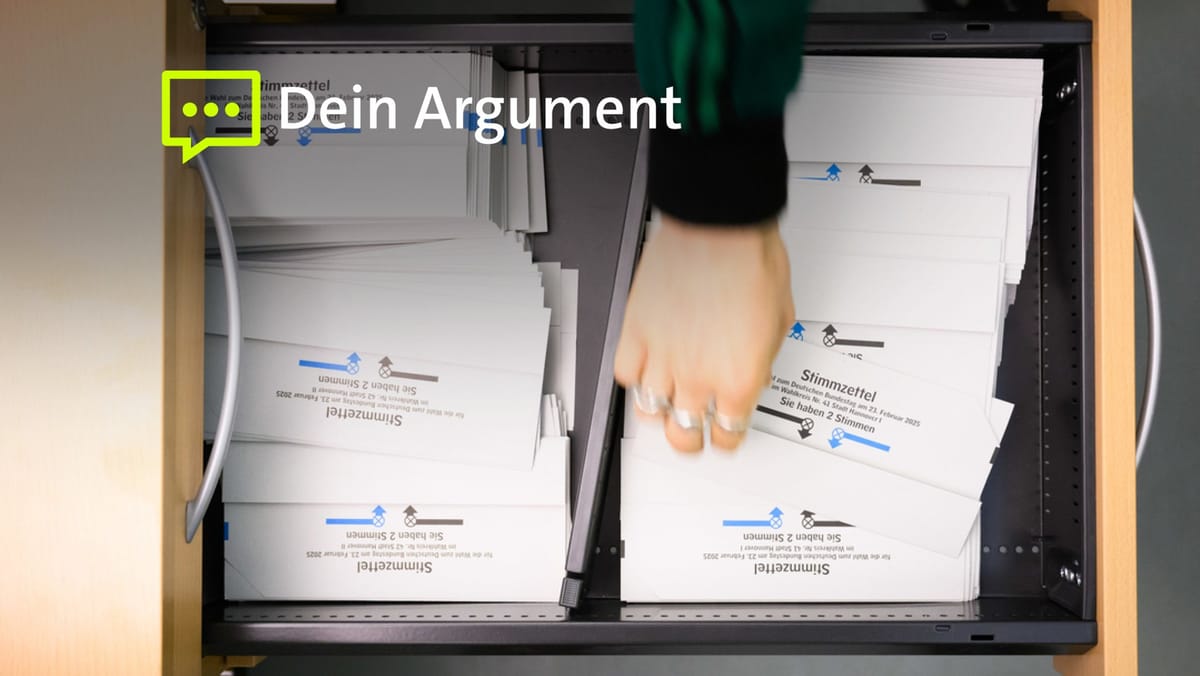Wenn Zahlen für Verwirrung sorgen
Es ist ein Phänomen, das vor jeder Wahl auftritt: Kaum eine Woche vergeht, ohne dass neue Umfragen die politische Landschaft durcheinanderwirbeln. Mal gewinnt eine Partei plötzlich mehrere Prozentpunkte hinzu, mal rutscht eine andere ab – und jeder fragt sich: Ist das wirklich die Stimmung im Land oder nur ein statistisches Artefakt?
Jüngstes Beispiel: Das Institut YouGov gibt der kriselnden Linkspartei plötzlich neun Prozent – ein erstaunlicher Sprung, wenn man bedenkt, dass andere Institute sie bei sechs oder sieben Prozent sehen. Gleichzeitig taxiert YouGov die Union auf nur 27 Prozent, während andere Meinungsforscher sie mit bis zu 32 Prozent deutlich stärker einschätzen.
Diese Unterschiede werfen Fragen auf: Liegt es an der Auswahl der Befragten, an methodischen Feinheiten oder an einer bewussten Gewichtung der Daten?
Demoskopie als politische Waffe?
Wahlumfragen beeinflussen nicht nur die Wahrnehmung der Wähler, sondern auch den politischen Diskurs. Parteien nutzen sie, um Narrative zu untermauern – „Wir sind im Aufwind“, „Unsere Strategie wirkt“ oder „Die Konkurrenz verliert an Boden“ sind beliebte Botschaften. Doch wie verlässlich sind diese Zahlen wirklich?
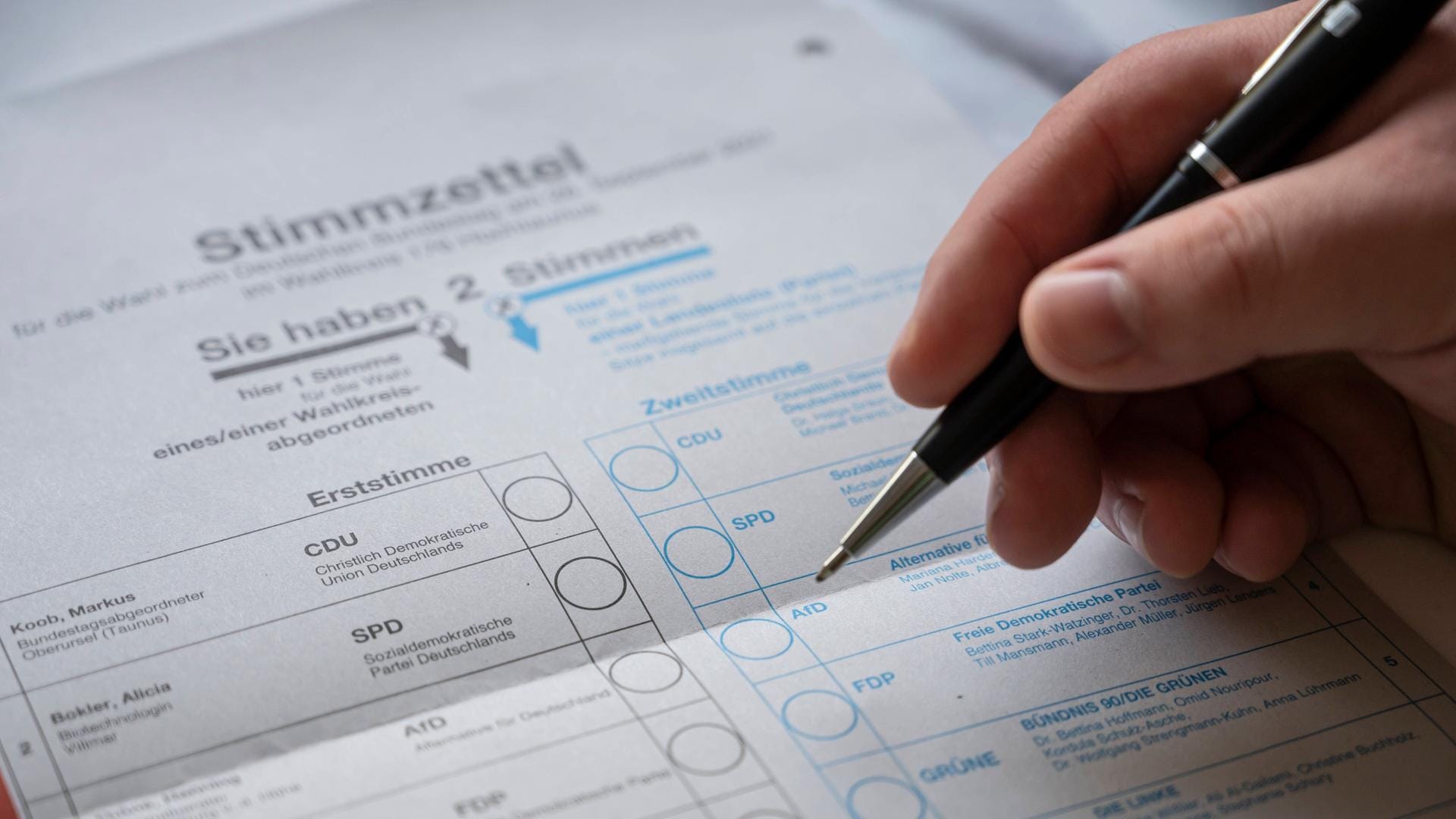
Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim warnt davor, Umfragen überzubewerten: „Sie sind Momentaufnahmen, keine Prognosen. Und sie unterliegen zahlreichen Verzerrungen – durch die Auswahl der Befragten, durch die Art der Fragestellung und durch die Gewichtung der Antworten.“
Dabei zeigt die Vergangenheit: Große Abweichungen von der Realität sind keine Seltenheit. Vor der Bundestagswahl 2021 sah YouGov die Linke bei sieben Prozent – am Wahltag schaffte sie nur 4,9 Prozent. Die FDP wurde von einigen Instituten überschätzt, während die SPD überraschend stark abschnitt.
Wie kommen die Zahlen zustande?
Die Methodik der Umfrageinstitute unterscheidet sich stark. Während einige per Telefon befragen, setzen andere auf Online-Panels oder hybride Modelle. Besonders problematisch: Immer weniger Menschen nehmen an Umfragen teil.
Während vor 20 Jahren noch 30 Prozent der Befragten antworteten, sind es heute weniger als zehn Prozent. Das bedeutet, dass die Institute die Ergebnisse mathematisch „nachjustieren“ müssen – eine Blackbox, die von außen kaum nachvollziehbar ist.
„Jede Umfrage wird gewichtet“, erklärt Brettschneider. „Man versucht, demografische Verzerrungen auszugleichen, indem man bestimmte Gruppen stärker berücksichtigt. Aber welche Parameter dabei einfließen, ist nicht transparent.“
Ein Beispiel: Wenn in einer Stichprobe besonders viele junge Menschen vertreten sind, die Linke oder Grüne bevorzugen, kann das Institut die Antworten der älteren Wähler „hochrechnen“. Doch wer garantiert, dass diese Annahmen korrekt sind?
Das Dilemma der Medienlandschaft
Medienhäuser veröffentlichen fast täglich neue Umfragen – weil sie Aufmerksamkeit generieren und Klicks bringen. Doch die ständigen Schwankungen verunsichern viele Wähler.
Studien zeigen: Menschen tendieren dazu, sich dem „stärkeren“ Lager anzuschließen (Bandwagon-Effekt) oder aus Mitleid einer schwächelnden Partei eine Chance zu geben.
Doch was, wenn diese Zahlen fehlerhaft sind? Oder wenn eine Partei durch eine zufällige Schwankung schlechter dasteht, ihre Anhänger demotiviert sind und am Ende tatsächlich weniger Stimmen erhält?
Das könnte Sie auch interessieren: