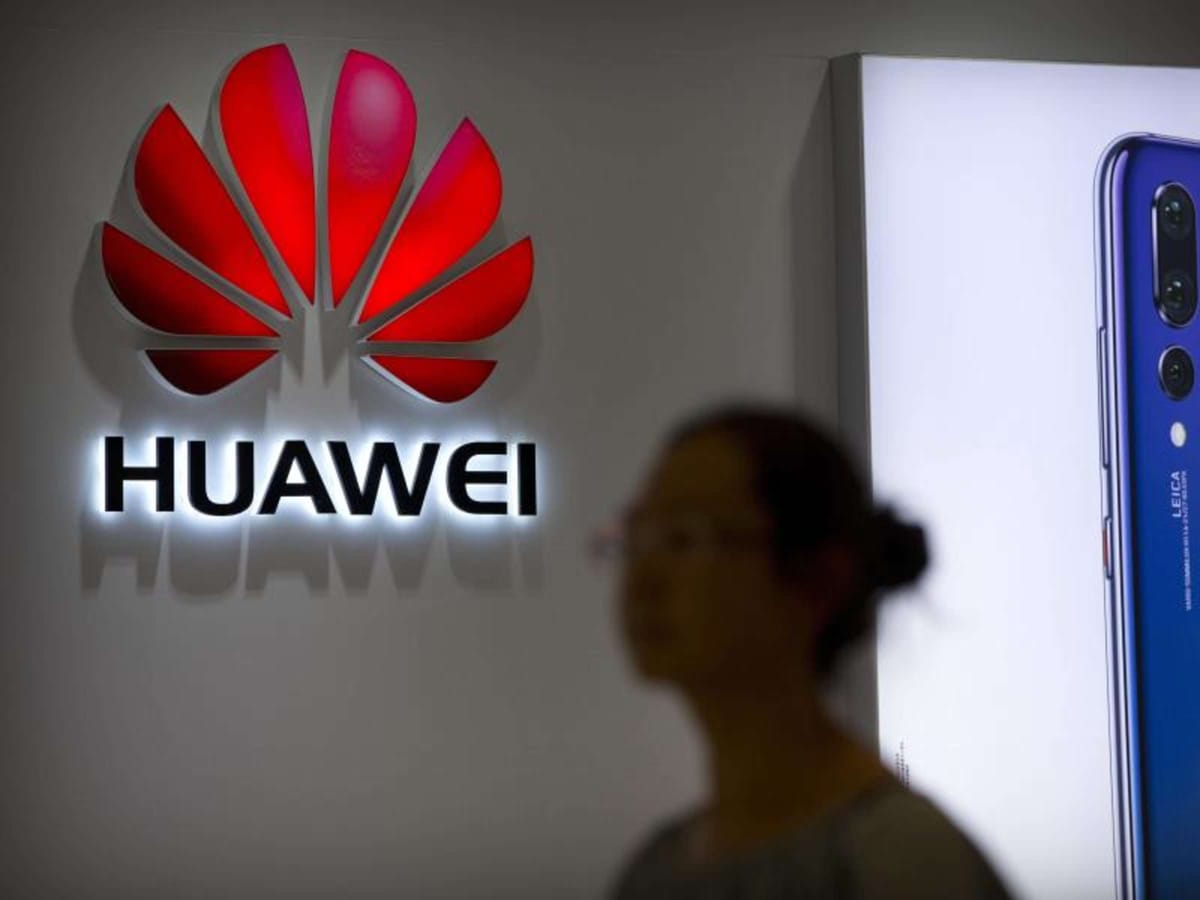1500 Euro für politischen Einfluss
Der Preis für europäische Integrität: 1500 Euro. So viel soll Huawei laut Ermittlungsunterlagen gezahlt haben, um Abgeordnete des Europäischen Parlaments zu einer prochinesischen Position im Streit um den 5G-Ausbau zu bewegen.
Das Schreiben, das acht Abgeordnete unterzeichneten, wurde gezielt an drei EU-Kommissare adressiert – mitten in einer Phase, in der die EU-Kommission Druck auf Mitgliedstaaten ausübte, Huawei aus sicherheitsrelevanten Netzen zu verbannen.
Was zunächst als einfacher Lobbyversuch erschien, entwickelt sich nun zu einem hochbrisanten Fall mutmaßlicher Bestechung.
Die belgische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Korruption, Geldwäsche und Einflussnahme auf legislativer Ebene. 21 Hausdurchsuchungen, mehrere Festnahmen und ein versiegeltes Abgeordnetenbüro zeugen von der Schwere der Vorwürfe.
Huawei, Brüssel und die Grauzonen des Einflusses
Im Zentrum der Ermittlungen steht das Brüsseler Büro von Huawei – konkret ein gewisser „Abraham L.“, mutmaßlicher Mittelsmann und Strippenzieher.
Er soll Zahlungen an parlamentarische Assistenten, Berater und angebliche Dienstleister organisiert haben. Die Geldflüsse, so der Vorwurf, seien verschleiert über Scheinrechnungen für Beratungsleistungen und Wahlkampfausgaben.
Dabei zeigt der Fall: Die Grenze zwischen Lobbyismus und Bestechung verläuft im Europäischen Parlament weiterhin fließend – und wird nur selten kontrolliert.
Denn: Obwohl bereits im Jahr 2022 mit Katargate ein Korruptionsskandal internationalen Ausmaßes Brüssel erschütterte, hat das EU-Parlament seine internen Kontrollmechanismen bis heute nicht ernsthaft reformiert.
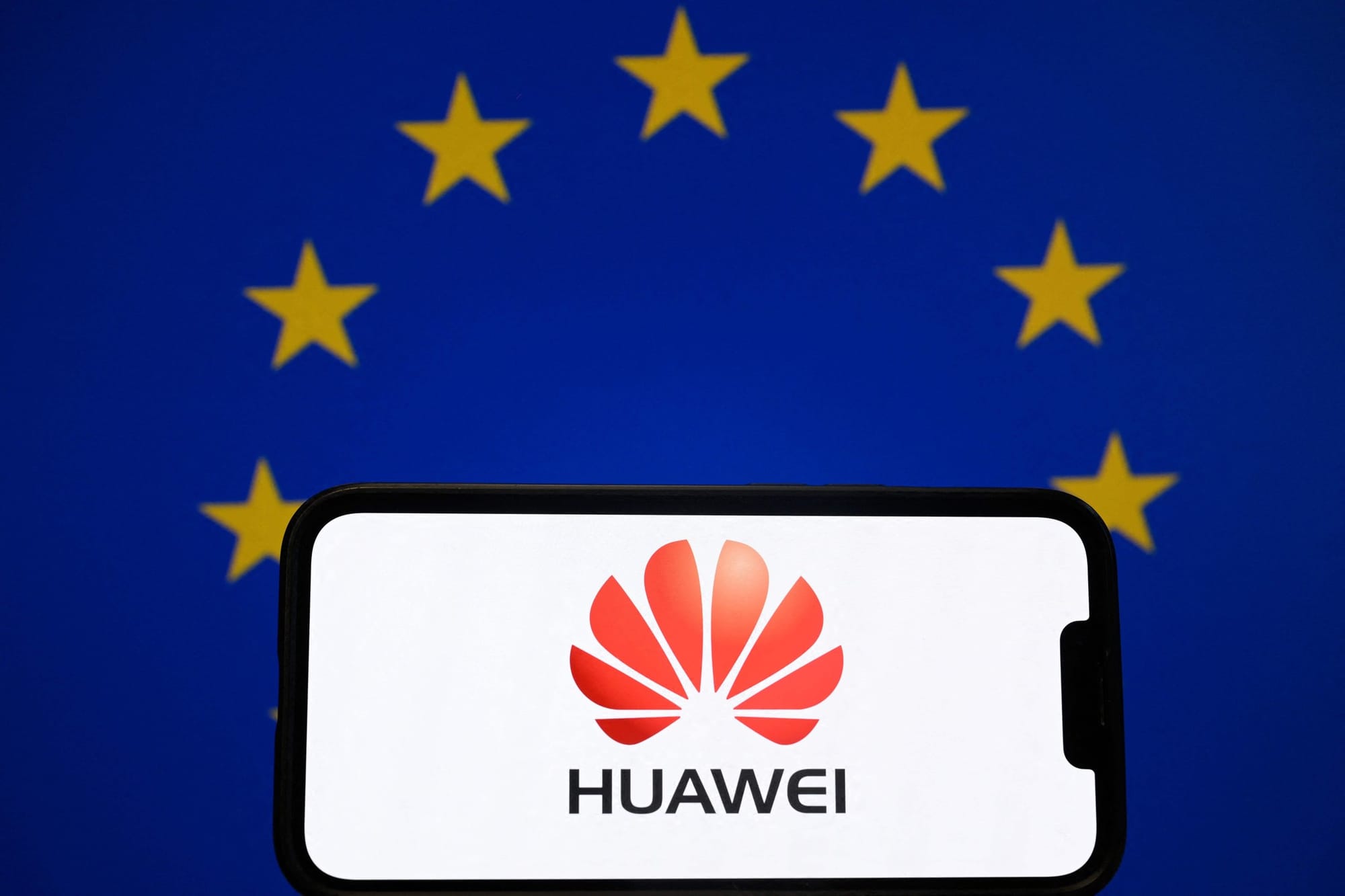
Ethikaufsicht? Fehlanzeige.
Nach Katargate versprach das Parlament die Einrichtung einer unabhängigen Ethikkommission. Bis heute existiert sie nicht. Blockiert wird das Gremium laut Abgeordneten wie Daniel Freund (Grüne) vor allem von der konservativen EVP und rechten Gruppen – denselben Kräften, die jetzt in den Huawei-Skandal verwickelt sein könnten.
Die Folge: Auch dieser Fall wurde nicht durch interne Aufklärung aufgedeckt, sondern durch externe Ermittlungen – auf Basis von Hinweisen europäischer Geheimdienste. Die belgische Justiz ist es, nicht das Parlament selbst, die nun Licht ins Dunkel bringt. Wieder einmal.
Der Skandal trifft ein fragiles Vertrauen
Für die europäische Öffentlichkeit ist der Huawei-Fall mehr als nur ein weiteres Kapitel in der langen Geschichte parlamentarischer Grauzonen. Er trifft die Glaubwürdigkeit einer Institution, die längst mehr als nur eine Diskussionsplattform ist – sie ist Mitgesetzgeber, Haushaltsbehörde und geopolitischer Akteur.
Gerade im Kontext wachsender Spannungen zwischen China und der EU, etwa im Bereich Handel, kritischer Infrastruktur und Technologie, wiegt der Vorwurf schwer.
Der Versuch, über Zahlungen an Abgeordnete indirekten Einfluss auf Gesetzgebung zu nehmen, wäre nicht nur ein Verstoß gegen Ethikrichtlinien, sondern ein Eingriff in die politische Souveränität Europas.
Huawei schweigt – doch die Folgen dürften laut werden
Huawei selbst ließ Anfragen zu den Vorwürfen unbeantwortet. In Brüssel allerdings beginnt das politische Nachbeben: Forderungen nach lückenloser Aufklärung werden lauter.
Auch Fragen zur Rolle der EU-Kommission, die das Parlament bisher auffällig diskret agieren ließ, dürften aufkommen. Schließlich geht es um Einflussnahme auf zentrale Weichenstellungen der europäischen Infrastrukturpolitik.
Hinzu kommt: Der Skandal trifft das Parlament kurz vor der Europawahl. Das Timing könnte kaum ungünstiger sein – und das Vertrauen in politische Institutionen weiter erodieren lassen.
Das könnte Sie auch interessieren: