Es war absehbar, doch nun ist es offiziell: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Zinsen gesenkt – und damit den positiven Realzins für Sparer beendet. Der Einlagensatz sinkt auf 2,75 Prozent und liegt damit erstmals seit 2023 wieder unter der deutschen Inflationsrate von 2,8 Prozent. Wer sein Geld auf Tagesgeldkonten oder in Festgeldparken möchte, verliert real an Kaufkraft.
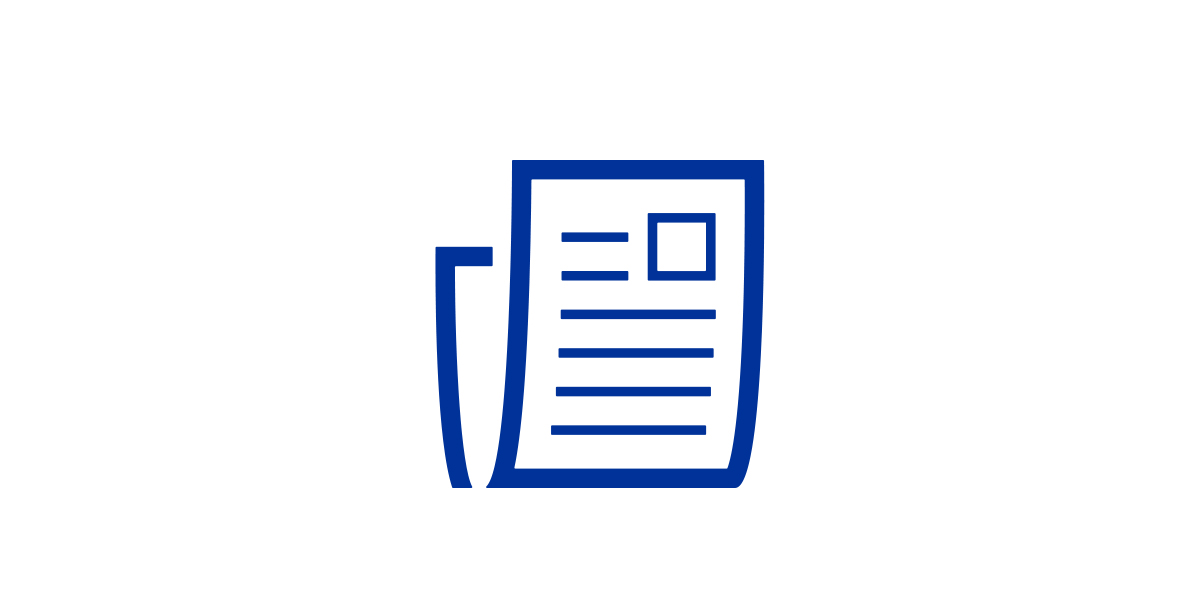
Damit sind die goldenen Zeiten für Zinssparer vorerst vorbei. Jede Sparanlage, die nicht mindestens die Inflationsrate ausgleicht, bedeutet realen Wertverlust. Doch es gibt Alternativen – einige davon lohnenswert, andere riskant.
Warum sich klassisches Sparen nicht mehr lohnt
Noch vor wenigen Monaten konnten Sparer dank der hohen EZB-Zinsen auf risikoarme Geldanlagen setzen. Banken boten attraktive Tagesgeld- und Festgeldkonten, die zumindest annähernd die Inflation ausglichen. Doch mit dem jüngsten Zinsschritt wird das schwierig.
Laut Verivox sind die Festgeldzinsen für zwei Jahre auf durchschnittlich 2,24 Prozent gefallen – das niedrigste Niveau seit zwei Jahren. Tagesgeldkonten bieten teilweise noch attraktive Neukundenkonditionen, doch viele sind zeitlich begrenzt und mit Bedingungen verknüpft.
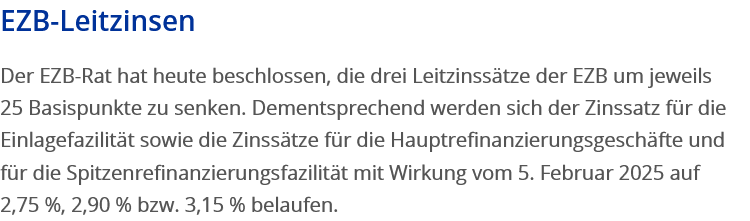
Die Folge: Selbst wer sein Geld bei einer der wenigen Banken anlegt, die den EZB-Einlagensatz direkt weitergeben, wird real Kaufkraft verlieren.
Drohen weitere Zinssenkungen?
EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte auf der ersten Zinssitzung des Jahres klar, dass dies erst der Anfang sein könnte. Sie ließ offen, wie schnell und wie weit die Zinsen in den kommenden Monaten sinken. Experten der Commerzbank rechnen mit zwei bis drei weiteren Zinsschritten nach unten.
Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, könnten Sparer schon bald mit noch niedrigeren Renditen konfrontiert sein.
An den Finanzmärkten ist die Botschaft angekommen: Investoren preisen bereits weitere Zinssenkungen ein.

Welche Alternativen bleiben Sparern jetzt?
1. Renditestärkere Anleihen – aber mit Risiko
Wer weiterhin in festverzinsliche Produkte investieren möchte, muss bereit sein, ins Risiko zu gehen. Besonders attraktiv sind derzeit US-Staatsanleihen, die im Gegensatz zu europäischen Bonds noch Zinsen über vier Prozent bieten.
Doch hier lauert das Währungsrisiko: Wer in Dollar denominierte Anleihen investiert, profitiert nur dann, wenn der Euro gegenüber dem Dollar nicht stark aufwertet. Auch Unternehmensanleihen mit höheren Renditen könnten eine Alternative sein – allerdings ist das Ausfallrisiko je nach Bonität des Unternehmens nicht zu unterschätzen.
2. ETFs und Aktien als langfristige Lösung
Wer den Inflationsschutz dauerhaft sichern will, kommt an Aktien nicht vorbei. Breite Aktien-ETFs wie der MSCI World oder der MSCI All Country World bieten langfristig eine durchschnittliche Rendite von 6–8 Prozent pro Jahr – weit über der aktuellen Inflation.
Gerade Unternehmen mit starken Dividenden und stabilen Geschäftsmodellen sind eine beliebte Wahl für Anleger, die nicht nur von Kurssteigerungen, sondern auch von regelmäßigen Ausschüttungen profitieren wollen.
3. Gold und Bitcoin – Absicherung gegen Kaufkraftverlust?
Wenn Zinsen real negativ sind, gewinnen inflationsgeschützte Anlageklassen an Attraktivität. Gold hat sich traditionell als Sicherheit in Phasen geldpolitischer Unsicherheiten bewährt.
In den letzten Monaten hat auch Bitcoin an Bedeutung gewonnen. Die Kryptowährung erreichte kürzlich ein neues Allzeithoch von über 100.000 Dollar. Während Gold von der Zinssenkung profitierte und auf 2.790 Dollar kletterte, legte Bitcoin um zwei Prozent zu.
Ob Bitcoin wirklich als Inflationsschutz taugt, bleibt umstritten. Während einige Experten die digitale Währung als „das neue Gold“ bezeichnen, warnen andere vor hoher Volatilität und regulatorischen Risiken.
Notenbanken und Bitcoin – eine neue Ära?
Interessant ist, dass Bitcoin nicht nur bei privaten Anlegern, sondern auch bei Notenbanken auf Interesse stößt. Die Tschechische Zentralbank erwägt, einen Teil ihrer Währungsreserven in Bitcoin anzulegen – ein Novum für eine westliche Zentralbank.
Während EZB-Chefin Lagarde diese Idee scharf zurückwies, hat sich in den USA ein anderer Ton durchgesetzt. Donald Trump, bekannt für seine Krypto-freundliche Haltung, hat eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die prüft, ob die US-Regierung eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen sollte.
In Deutschland gibt es ebenfalls erste Stimmen, die Bitcoin als Reservewährung fordern – darunter FDP-Chef Christian Lindner.

