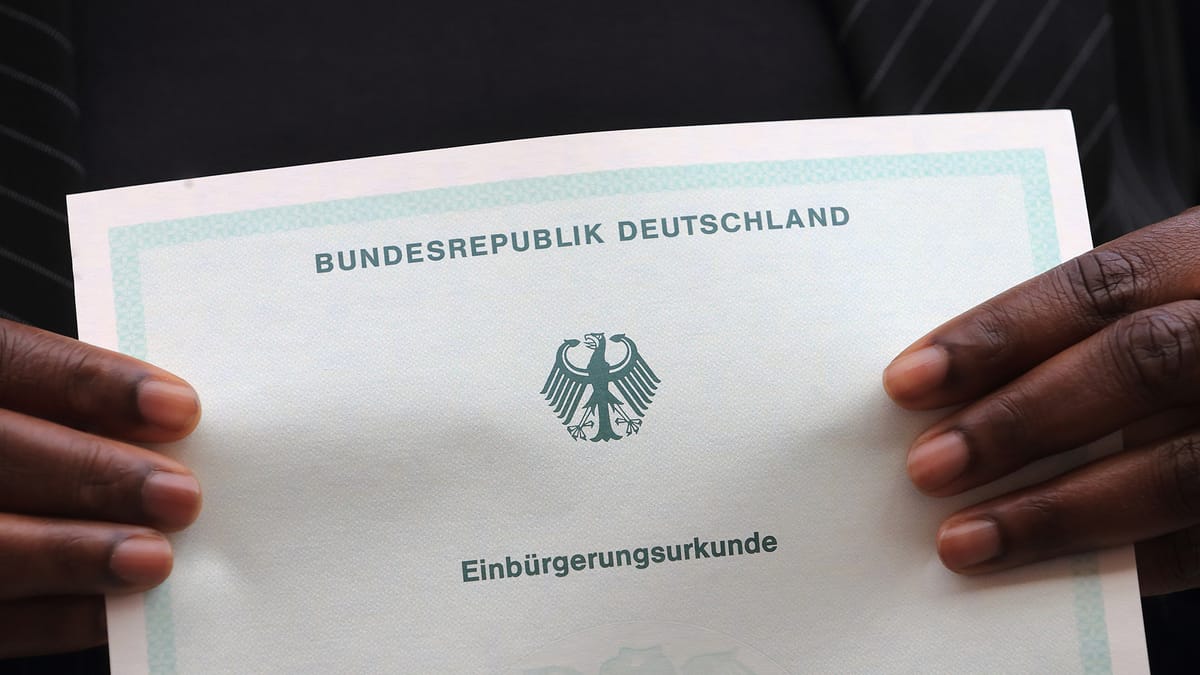Ein kurzer Moment, eine einfache Frage – und doch entfacht das Video eines Kanzlerbesuchs in Nürnberg eine hitzige Debatte.
Olaf Scholz trifft eine 93-jährige türkischstämmige Frau, die erst kürzlich die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat. Doch als der Kanzler sie auf Deutsch anspricht, bleibt sie stumm. Erst die Übersetzung ins Türkische sorgt für eine Reaktion.
Der Clip, veröffentlicht von einem türkischen Journalisten, sorgt für Schlagzeilen – und für Kritik an der Einbürgerungsreform der Ampel-Koalition. Wie viel Integration ist nötig, um Deutsche oder Deutscher zu werden? Und was bedeutet dieser Fall für die neue Regelung?
Einbürgerung ohne Sprachkenntnisse – Ausnahme oder System?
Die 93-jährige Fatma T. ist seit Jahrzehnten in Deutschland, hat hier gelebt, gearbeitet und nun die Staatsbürgerschaft erhalten. Dass sie die einfache Frage des Kanzlers nicht versteht, sorgt dennoch für Irritation. Kritiker sehen darin den Beweis, dass die Ampel die Einbürgerung zu stark erleichtert hat.
Denn mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts hat die Koalition die Hürden für den Pass deutlich gesenkt. Seit Mitte 2024 reicht es in vielen Fällen, wenn sich Antragsteller im Alltag „ohne nennenswerte Probleme“ verständigen können – besonders für Angehörige der sogenannten Gastarbeitergeneration wurden die Anforderungen an Sprachkenntnisse massiv gesenkt. Auch auf den sonst verpflichtenden Einbürgerungstest wird in diesen Fällen verzichtet.
„Die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht zum Ramschprodukt werden.“
So kommentierte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann die Reform bereits im vergangenen Jahr. Die Opposition befürchtet, dass die neuen Regeln Anreize setzen, sich ohne tiefe gesellschaftliche Integration einbürgern zu lassen.

Scholz Besuch: Wahlkampfgeste oder unglücklicher Moment?
Das Video sorgt für Gesprächsstoff, nicht nur in Deutschland. Türkische Medien berichten positiv über das Treffen, betonen die „große Geste“ des Kanzlers, der sich bewusst die Zeit für Fatma T. genommen habe. Doch die Debatte in Deutschland verläuft anders:
„Einbürgerung sollte ein bewusstes Bekenntnis zu Deutschland sein – nicht einfach eine Formalie.“
So äußerte sich ein FDP-Abgeordneter anonym gegenüber der Presse. Auch in den sozialen Medien sorgt der Fall für Diskussionen. Viele kritisieren, dass die Staatsbürgerschaft zunehmend als bloßer Verwaltungsakt behandelt werde, ohne dass eine tiefere Integration gefordert werde.
Gleichzeitig weist die SPD darauf hin, dass Fatma T. eine Ausnahme sei – eine Frau, die Deutschland mit aufgebaut habe und nun in hohem Alter den deutschen Pass bekomme. Ein Dank für ein Lebenswerk, kein Regelbruch.
Einbürgerungsboom in Deutschland – und überforderte Behörden
Fakt ist: Die Zahl der Einbürgerungen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Während 2020 noch rund 100.000 Menschen den deutschen Pass erhielten, waren es 2023 bereits knapp 200.000. Mit der Reform könnte diese Zahl weiter in die Höhe schnellen – was viele Kommunen bereits jetzt an die Belastungsgrenze bringt.
Besonders syrische und afghanische Staatsbürger, die ab 2015 nach Deutschland kamen, stellen immer mehr Anträge. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für eine Einbürgerung liegt mittlerweile bei über zwölf Monaten, in einigen Städten sogar bei zwei Jahren.
Das könnte Sie auch interessieren: