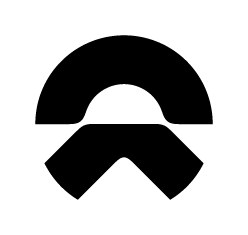Ein fünfstöckiger Champagnerturm auf der Motorhaube eines Elektroautos – und kein einziger Tropfen verschüttet: Mit diesem medienwirksamen Stunt präsentierte Nio sein neues Topmodell ET9 auf der Automesse in Shanghai.
Der ehemalige VW-Chef Herbert Diess war beeindruckt. Doch hinter der Inszenierung steckt mehr als bloß Marketing: Der ET9 ist ein Paradebeispiel für Chinas Aufstieg zum Technologieführer im Automobilbau – und für die wachsende Kluft zwischen technischer Überlegenheit und wirtschaftlichem Erfolg.
Nio steht symbolisch für eine neue Generation chinesischer Automarken, die auf softwaredefinierte Fahrzeuge setzen. Mit über 7000 Softwareentwicklern von insgesamt 11.000 Ingenieuren und einem eigens entwickelten Prozessor, dem Shenji NX9031, will das Unternehmen nicht nur Tesla, sondern auch etablierte deutsche Marken wie BMW oder Mercedes hinter sich lassen.

Der Bordcomputer koordiniert in Echtzeit sämtliche Fahrzeugkomponenten, der Sprachassistent „Nomi“ reagiert intuitiv auf Befehle und bietet eine emotionale Interaktion mit dem Fahrer – ganz im Sinne des Trends zur „User Experience“ im Auto.
Doch der Erfolg auf technischer Ebene kontrastiert mit der wirtschaftlichen Realität: Gerade einmal 398 Fahrzeuge konnte Nio im vergangenen Jahr in Deutschland verkaufen. Die hochmodernen Flagship-Stores in bester Innenstadtlage wirken angesichts dieser Zahlen beinahe surreal.

In Europa regiert Misstrauen – nicht nur gegenüber der Marke, sondern auch gegenüber chinesischer Software allgemein. Datenschutzbedenken wie das laufende Verfahren des bayerischen Landesamts gegen Nio wegen möglicher Datenabflüsse nach China verschärfen das Imageproblem zusätzlich.
Hinzu kommt die geopolitische Komponente: Die USA haben unter Präsident Joe Biden ein Importverbot für Fahrzeuge mit chinesischer Software ab 2027 verhängt. Donald Trump will zusätzlich massive Zölle durchsetzen. Auch in Europa sind protektionistische Tendenzen spürbar – die viel beschworene Flut chinesischer Elektrofahrzeuge bleibt bislang aus.
Technologische Pannen wie fehlerhafte Fahrerassistenzsysteme oder der mitunter nervige Nomi-Bot trüben das Nutzererlebnis weiter. Viele Kunden deaktivieren den Sprachassistenten nach dem Kauf – sei es aus Irritation, sei es aus Sorge vor möglichem Lauschangriff.
Lesen Sie auch:

Während Nio Milliarden für Forschung, Entwicklung und Expansion investiert, ist das Geschäftsmodell bislang ein Zuschussgeschäft. Ohne staatliche Unterstützung aus China und Finanzspritzen arabischer Investoren wäre die Marke wohl längst Geschichte.
Selbst im eigenen Haus rumort es: In Europa geben Länderchefs regelmäßig auf, zuletzt auch in Deutschland. Die Entscheidungswege bleiben undurchsichtig, zentrale Vorgaben kommen meist aus Shanghai.
Das alles zeigt: Hightech allein macht noch keinen Markterfolg. Wer im globalen Automarkt bestehen will, muss nicht nur programmieren, sondern auch Vertrauen aufbauen. Und das lässt sich nicht mit Champagner beweisen.