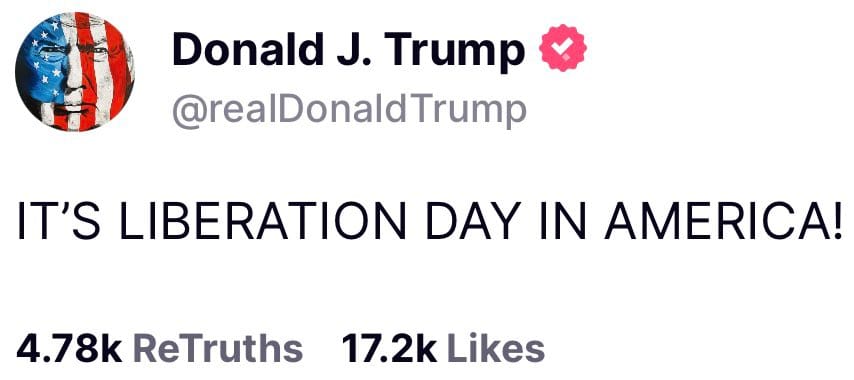Der Dollar gerät ins Schleudern
Als Donald Trump Anfang April im Rosengarten des Weißen Hauses seine neuen Zölle verkündete, wirkten die Aussagen martialisch – aber wie gewohnt kalkuliert. Was damals kaum jemand ahnte: Die Märkte nahmen ihn diesmal beim Wort. Erst reagierten die Börsen, jetzt dreht der Devisenmarkt durch.
Der Dollar hat seit Jahresbeginn rund zehn Prozent an Wert verloren. Inzwischen schwankt die US-Währung täglich um bis zu drei Prozent – ein Verhalten, das man sonst von instabilen Schwellenländern kennt. Nicht von der führenden Reservewährung der Welt.
Ein gefährliches Spiel mit dem Vertrauen
Der Dollar war über Jahrzehnte das Fundament des globalen Finanzsystems. Seine Stärke galt als Garant für Sicherheit. Doch genau dieses Vertrauen erodiert. Investoren stellen plötzlich die Frage, die bislang als tabu galt: Ist der Dollar noch die richtige Leitwährung?
George Saravelos, Devisenstratege der Deutschen Bank, spricht von einer schleichenden „Ent-Dollarisierung“. Was so technisch klingt, ist für die USA hochpolitisch – und potenziell existenzbedrohend.
Zwei Großmächte rasen aufeinander zu
Der Konflikt zwischen den USA und China nimmt Züge eines ökonomischen „Chicken Games“ an. Beide Seiten setzen auf Eskalation. Keiner will ausweichen. Doch wenn beide hart bleiben, droht der Crash.
Und genau in diesem Zustand befinden sich die Märkte. Die Unsicherheit hat längst auf die Währungen übergegriffen. Während der Euro aufwertet, verliert der Dollar in rasantem Tempo an Boden.
Der Markt traut Amerika nicht mehr
Die Bewegungen an den Kapitalmärkten sind ein Seismograph für Vertrauen. Und das Vertrauen in die USA scheint zu bröckeln. JP Morgan schreibt in einem Marktkommentar von einem „fundamentalen Umdenken“, das aktuell stattfinde. Amerika werde als Investitionsstandort zunehmend kritisch gesehen – und das drücke sich nun in der Währung aus.

Die Analyse ist klar: Wenn sich Investoren nicht mehr auf den Dollar verlassen können, suchen sie Alternativen. Und die gibt es – in Europa, in Asien, vielleicht sogar in digitalen Währungen.
China hält die besseren Karten
Dass China im Moment nicht in Panik verfällt, ist kein Zufall. Die Volksrepublik gehört zu den größten Gläubigern der USA. Über 700 Milliarden Dollar an amerikanischen Staatsanleihen liegen in Pekings Händen.
Die chinesische Führung könnte also mit einem einzigen Verkaufssignal den US-Finanzmarkt ins Wanken bringen. Noch hält sie sich zurück – aber allein die Möglichkeit reicht, um Unruhe zu stiften.
Zudem kann China Kapitalverkehrskontrollen nutzen, um das eigene System zu stabilisieren. Die Führung in Peking muss keine Panikverkäufe fürchten. Die USA hingegen sind auf ausländisches Geld angewiesen – und das macht sie angreifbar.
Trumps Politik zeigt erste Nebenwirkungen
Was Trump als „America First“ verkauft, wird für das eigene Land zur Hypothek. Ein Beispiel: Die Zinsen für 30-jährige US-Staatsanleihen steigen auf fast fünf Prozent – und das in einem Umfeld, das eigentlich von Rezessionsangst geprägt ist.
Normalerweise flüchten Anleger in Staatsanleihen, wenn Unsicherheit herrscht. Doch diesmal bleiben sie fern. Der Grund: Zweifel an der Schuldentragfähigkeit der USA. Und Zweifel an der politischen Führung.
Ein teures Spiel mit den Zinsen
Die USA zahlen mittlerweile jährlich rund 1,2 Billionen Dollar an Zinsen – mehr als ihr gesamtes Verteidigungsbudget. Das Schuldenniveau ist gewaltig: Über 36 Billionen Dollar hat der Staat angehäuft.
Neun Billionen davon gehören ausländischen Investoren. Sollte dieses Vertrauen weiter schwinden, wird die Finanzierung amerikanischer Politik zum Risiko – nicht nur für die USA selbst, sondern für das gesamte globale Finanzsystem.
Peking bleibt ruhig – und gewinnt
Während die USA mit ihrer Währung kämpfen, läuft es in China besser als gedacht. Der Hang Seng Technologieindex legt seit Jahresbeginn zehn Prozent zu. Der Nasdaq 100 hingegen verliert – auf Dollarbasis rund zwölf Prozent.
Auch hier zeigt sich: Das Vertrauen der Märkte verschiebt sich. Während die USA mit der Brechstange agieren, spielt China leise, aber effektiv. Der Vorteil liegt derzeit in Peking.
Zölle treffen beide Seiten – aber Amerika härter
Natürlich belasten Trumps hohe Einfuhrzölle auch China. Doch die Kosten tragen zunehmend amerikanische Verbraucher. Produkte aus Fernost werden teurer, Lieferketten reißen.
Der Alltag wird für viele Amerikaner schlicht teurer. Blackrock-Chef Larry Fink bringt es auf den Punkt: Sollte sich dieser Kurs fortsetzen, droht der US-Wirtschaft eine Stagflation – also das gefährliche Zusammenspiel von Inflation und wirtschaftlichem Stillstand.
2026 wird zur wirtschaftlichen Nagelprobe
Trump mag im Wahlkampf auf Provokation setzen, doch ökonomisch läuft ihm die Zeit davon. Bei den Zwischenwahlen 2026 werden sich die Folgen seiner Politik erstmals richtig bemerkbar machen. Wenn die Wirtschaft stagniert, Zinsen steigen und der Dollar weiter schwächelt, wird es schwer, den Kurs als Erfolg zu verkaufen. Die politischen Kosten könnten hoch ausfallen.
Das könnte Sie auch interessieren: