Der Traum vom Wohlstand gerät ins Wanken
Noch vor wenigen Jahren schien Chinas wirtschaftlicher Aufstieg unaufhaltsam. Während westliche Volkswirtschaften mit den Nachwirkungen der Pandemie kämpften, versprach Peking Stabilität, Wachstum und technologische Dominanz. Doch inzwischen ist von diesem Optimismus nicht mehr viel übrig.
Chinas Wirtschaft befindet sich im Krisenmodus. Der Immobiliensektor – das Fundament für das Vermögen von Millionen Chinesen – steht vor dem Zusammenbruch. Unternehmen wie Evergrande sind bereits kollabiert, andere wie Country Garden stehen kurz davor.
Die Deflation frisst den Binnenkonsum auf, während Xi Jinping mit immer neuen Staatsinterventionen versucht, das Ruder herumzureißen – bislang ohne Erfolg.
Das Ergebnis: Die Börsenkurse fallen seit Jahren, die ausländischen Investitionen sinken, und die chinesische Mittelschicht verliert das Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft ihres Landes. Ein neuer Wachstumsmotor ist nicht in Sicht – oder doch?
Ein Immobilienmarkt in Trümmern
Seit 2021 kämpft China mit einer sich zuspitzenden Immobilienkrise. 17 Billionen US-Dollar an Marktwert sind bereits verloren gegangen – eine Summe, die dem Wertverlust des US-Immobilienmarkts während der Finanzkrise 2008 entspricht.
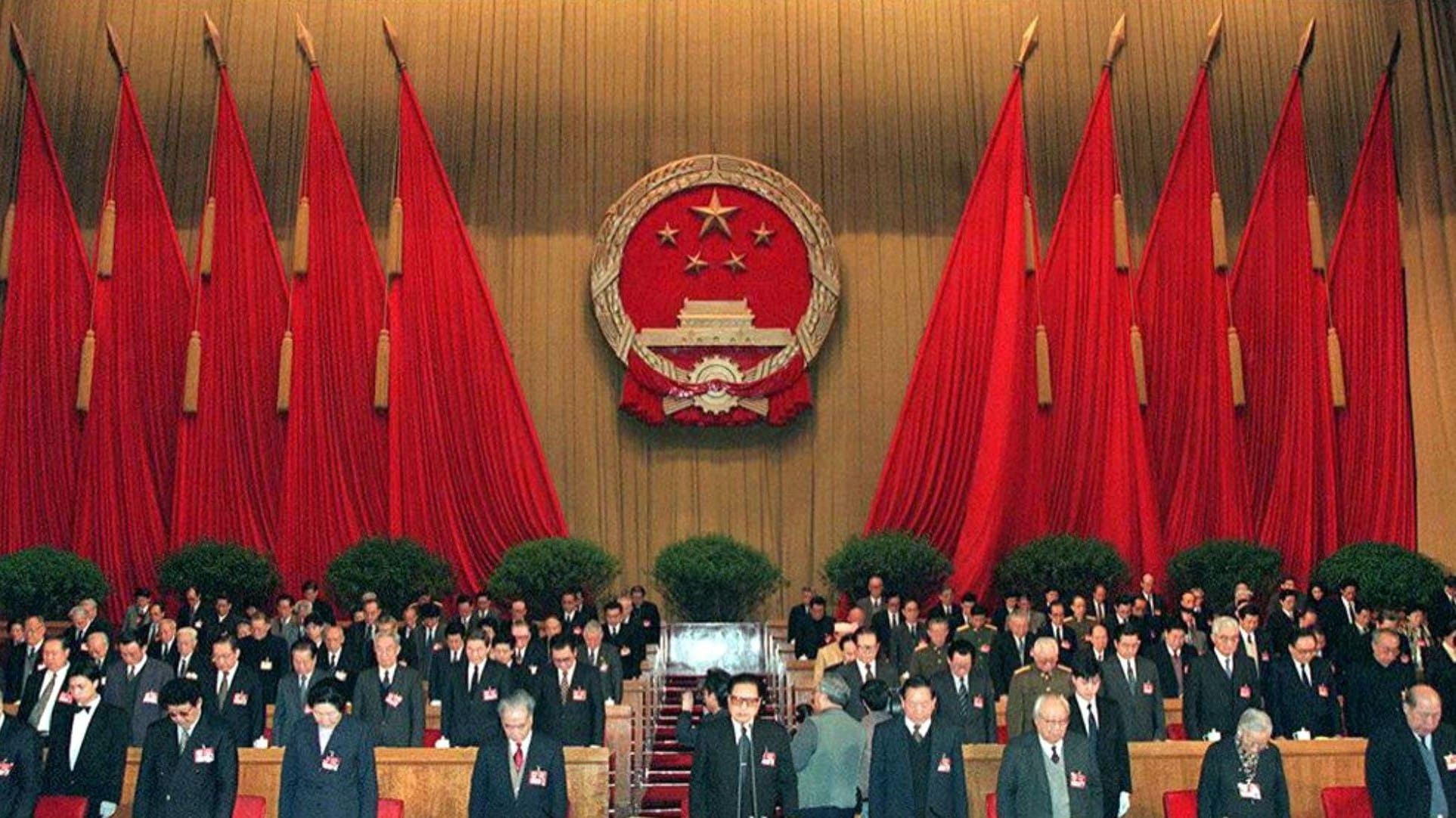
Doch anders als in den USA gibt es in China keine starke Vernetzung zum Ausland. Die Verluste treffen vor allem die chinesischen Haushalte, die rund 70 Prozent ihres Vermögens in Immobilien gebunden haben. Für viele ist das eine existenzielle Katastrophe.
„Die chinesische Immobilienblase war von einer völlig anderen Dimension als alles, was wir im Westen erlebt haben“, sagt Harald Preißler, Kapitalmarktstratege bei Bantleon. „Die Regierung hat die Spekulationen jahrelang angeheizt, bis das System implodierte.“
Deflation als tickende Zeitbombe
Während die USA und Europa nach Jahren hoher Inflation eine Stabilisierung erleben, steckt China in der entgegengesetzten Falle: Deflation.
Sinkende Preise mögen für Konsumenten zunächst attraktiv klingen, doch sie haben gravierende Folgen für die Wirtschaft. Unternehmen verschieben Investitionen, da sie befürchten, ihre Produkte in Zukunft nur noch günstiger verkaufen zu können.
Gleichzeitig wächst die reale Schuldenlast, da Kredite nominal gleich bleiben, während die Einnahmen fallen.
Das Problem wird durch Chinas restriktive Wirtschaftspolitik noch verschärft. Statt den Konsum anzukurbeln, setzt Xi Jinping auf staatliche Interventionen und Industrieinvestitionen – ein Modell, das lange funktionierte, aber inzwischen an seine Grenzen stößt.
900 Milliarden US-Dollar an Staatsinterventionen – ohne Wirkung
Die chinesische Regierung hat auf die Krise mit gigantischen Finanzspritzen reagiert. Seit Herbst 2023 flossen rund 900 Milliarden US-Dollar in Banken, Kommunen und Aktienmärkte.
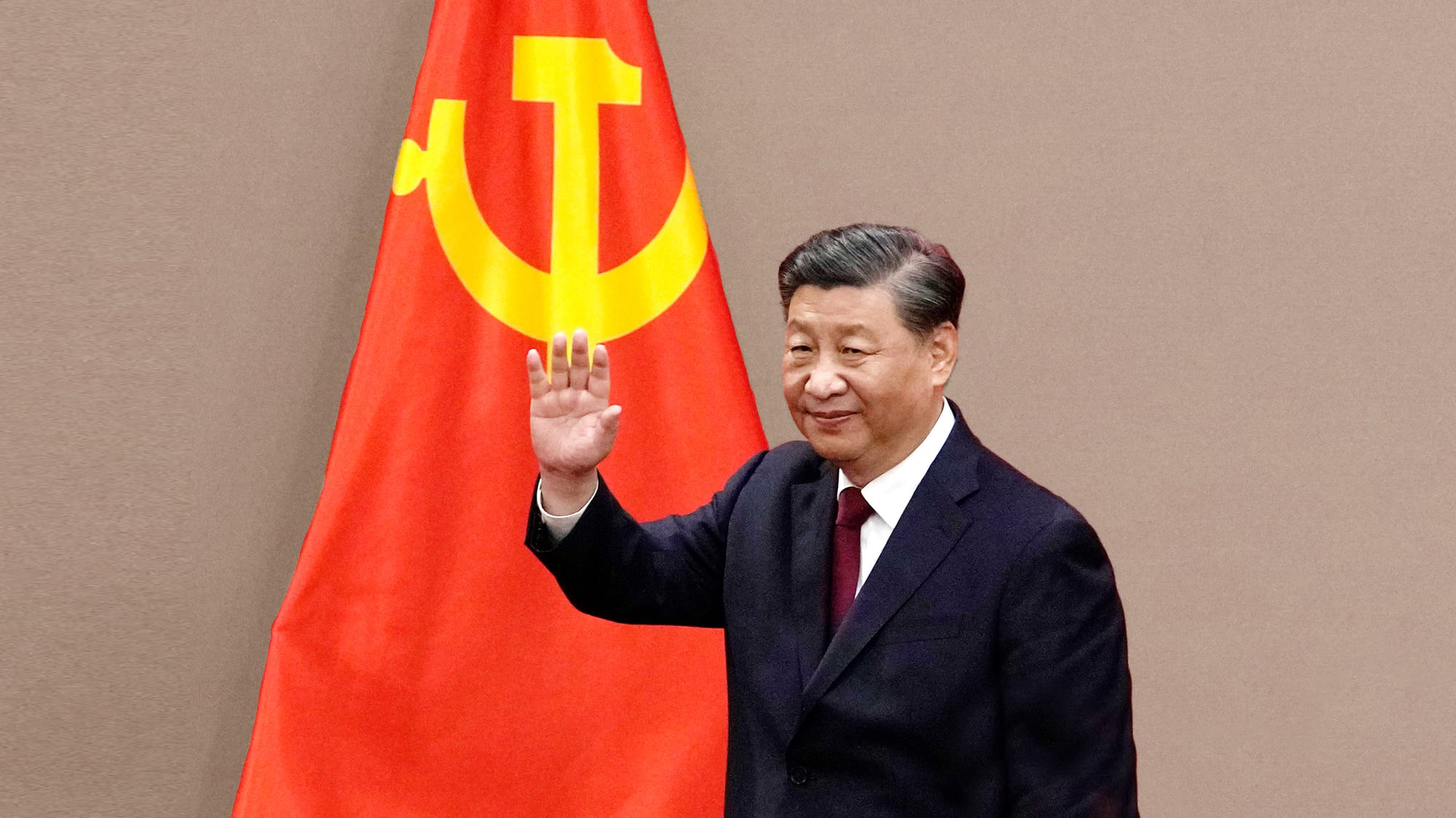
Doch der Effekt blieb aus. Zwar gab es kurzfristige Erholungen an den Börsen, doch eine Trendwende blieb aus. Investoren ziehen ihr Kapital weiter ab, die Renditen chinesischer Staatsanleihen sind mittlerweile niedriger als die Japans – ein klares Zeichen, dass die Märkte China mit einer langanhaltenden Wachstumsschwäche rechnen.
„Wir erleben eine schleichende Japanisierung der chinesischen Wirtschaft“, warnt Elke Speidel-Walz, Chefökonomin für Schwellenländer bei DWS. „Wachstum stagniert, Preise sinken, und die Regierung steuert mit immer mehr Bürokratie dagegen – ein fatales Rezept.“
Lesen Sie auch:

Xi Jinping: Ein Präsident ohne wirtschaftliches Verständnis?
Für viele Ökonomen liegt die Schuld für Chinas wirtschaftliche Misere in der Person Xi Jinpings. Der Präsident setzt zunehmend auf Staatskontrolle und Zentralisierung, während er marktwirtschaftliche Reformen blockiert.
Ein Beispiel für sein mangelndes ökonomisches Verständnis: Als China 2023 in eine Phase anhaltender Deflation rutschte, soll Xi laut internen Berichten gefragt haben:
„Mögen die Menschen es denn nicht, wenn Waren günstiger werden?“
Doch genau hier liegt das Problem. Deflation führt dazu, dass Unternehmen weniger investieren, weil sie niedrigere Gewinne erwarten. Gleichzeitig wächst die reale Schuldenlast, da Kredite nicht inflationsbereinigt sinken.
„Statt wirtschaftliche Reformen voranzutreiben, setzt Xi auf ein ineffizientes Staatsmodell, das immer weniger funktioniert“, kritisiert Nobelpreisträger Paul Krugman.
Ein Hoffnungsschimmer: China könnte den KI-Markt aufrollen
Doch während Chinas traditionelle Industrien in die Krise rutschen, gibt es einen Bereich, in dem das Land plötzlich mit einem echten Durchbruch auf sich aufmerksam macht: Künstliche Intelligenz (KI).
Vor wenigen Tagen präsentierte das chinesische Start-up Deepseek sein neues KI-Modell Deepseek R1. Es soll mit den besten US-Modellen wie GPT-5 mithalten können – jedoch zu einem Bruchteil der Kosten.
„Die Veröffentlichung hatte den Hauch eines Sputnik-Moments“, sagt Leopold Quell, Schwellenländerexperte bei Raiffeisen Capital Management.
Besonders brisant: Deepseek behauptet, dass sein Modell auch ohne die modernsten Nvidia-Chips aus den USA entwickelt wurde. Falls das stimmt, könnte es das westliche Technologie-Monopol ins Wanken bringen.
Bisher dominierten amerikanische Firmen wie OpenAI, Google und Microsoft den KI-Markt. Doch Deepseek könnte das ändern – und damit Chinas strategische Schwäche in anderen Sektoren zumindest teilweise ausgleichen.
Das könnte Sie auch interessieren:



