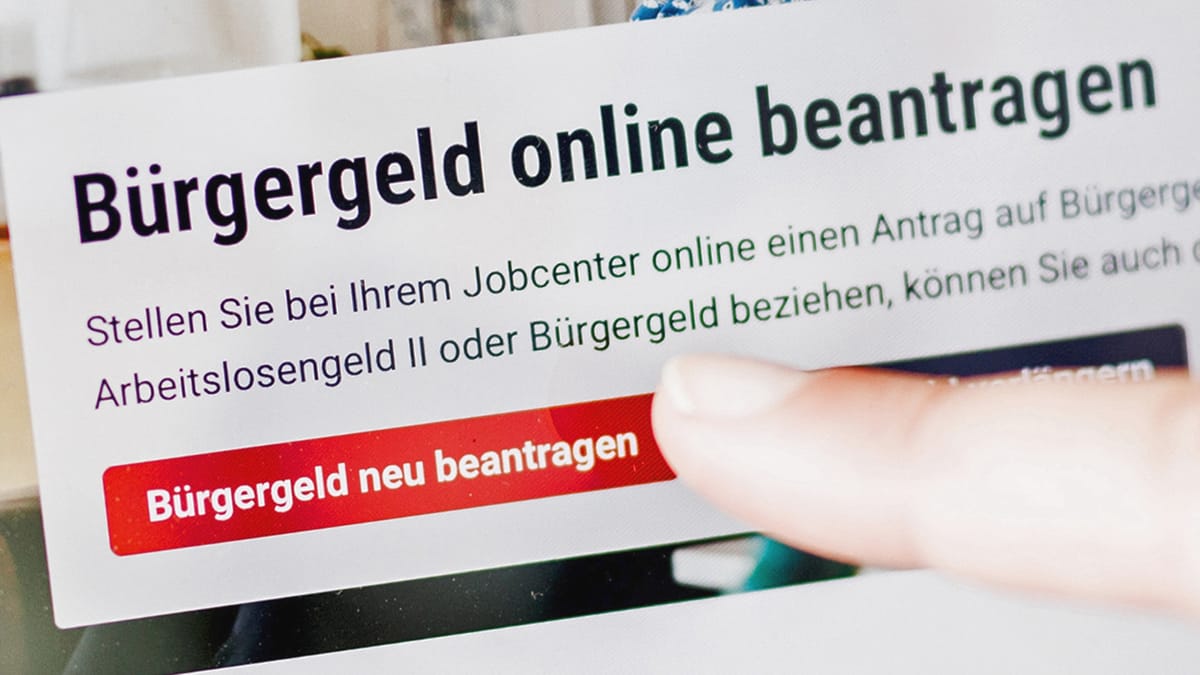Das Bürgergeld war als sozialpolitischer Befreiungsschlag gedacht – eine moderne Grundsicherung, die Chancen schafft und Abhängigkeiten abbaut. Zwei Jahre nach seiner Einführung fällt die Bilanz jedoch ernüchternd aus.
Die Arbeitsmarktintegration stockt, die Vermittlungsquote liegt unter den Erwartungen, und das System ist teurer als ursprünglich kalkuliert. Nun steht das Bürgergeld vor einer ungewissen Zukunft. Die Union verspricht eine Abschaffung, doch die gesetzlichen und politischen Realitäten sprechen eine andere Sprache.
Politische Realität: Abschaffung kaum durchsetzbar
Die CDU geht mit einer klaren Botschaft in den Wahlkampf: Das Bürgergeld muss weg. Spitzenpolitiker wie Markus Söder oder Carsten Linnemann argumentieren, das System setze zu geringe Anreize zur Arbeit und belaste die Steuerzahler unverhältnismäßig. Ihr Versprechen: Sollte die Union die nächste Regierung anführen, werde man das Bürgergeld abschaffen.

Doch diese Rhetorik hat ihre Grenzen. Zum einen sind die Grundsicherungsansprüche gesetzlich verankert. Eine vollständige Rückabwicklung wäre nicht nur juristisch heikel, sondern auch politisch riskant.
Zum anderen bräuchte die Union Koalitionspartner – und sowohl die Grünen als auch die SPD sind gegen eine fundamentale Abkehr vom Bürgergeld. Selbst eine schwarz-gelbe Koalition mit der FDP wäre wohl eher an Reformen als an einer Abschaffung interessiert.
Reform statt Revolution: Welche Änderungen realistisch sind
Realistischer als eine komplette Abschaffung sind strukturelle Anpassungen. Drei zentrale Reformansätze stehen zur Debatte:
- Härtere Sanktionen
Die CDU fordert eine konsequentere Handhabung von Sanktionen. Wer unbegründet nicht zu Beratungsterminen erscheint oder Weiterbildungsangebote ablehnt, soll mit Leistungskürzungen rechnen müssen. Auch die vollständige Streichung von Bürgergeld-Zahlungen bei wiederholten Pflichtverletzungen wird diskutiert. - Rückkehr zum Vermittlungsvorrang
Die Ampel-Regierung setzte auf Weiterbildung statt unmittelbare Vermittlung. Die Union will diesen Kurs umkehren: Vorrang soll wieder die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt haben – auch wenn das bedeutet, dass Menschen Jobs annehmen, die nicht optimal zu ihrer Qualifikation passen. - Pauschalisierung der Wohnkosten
Derzeit werden die Mietkosten von Bürgergeldempfängern in tatsächlicher Höhe übernommen, was in teuren Städten zu hohen staatlichen Ausgaben führt. Eine Umstellung auf Pauschalen würde Menschen in teuren Regionen stärker zur Kostensenkung zwingen – eine Maßnahme, die besonders in Großstädten für sozialen Sprengstoff sorgen könnte.
Die wirtschaftlichen Herausforderungen: Warum Reformen schwierig sind
Neben den politischen Hürden gibt es auch wirtschaftliche Argumente, die gegen eine komplette Abkehr vom Bürgergeld sprechen. Die konjunkturelle Lage ist angespannt, die Arbeitslosigkeit steigt, und viele Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. Doch während die einen behaupten, das Bürgergeld halte Menschen vom Arbeiten ab, argumentieren andere, dass es schlicht nicht genug Jobs gibt.

Besonders die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter schlägt sich in den Statistiken nieder. Diese Gruppe hat automatisch Anspruch auf Bürgergeld, was die Gesamtkosten in die Höhe treibt. Gleichzeitig fehlt es in den Jobcentern an Kapazitäten, um diese Menschen effizient in den Arbeitsmarkt zu integrieren.
Ein ungelöstes Problem: Die Transferentzugsrate
Ein wesentlicher Kritikpunkt am Bürgergeld ist, dass zusätzliche Erwerbstätigkeit sich oft kaum lohnt. Wer als Bürgergeld-Bezieher seine Arbeitsstunden aufstockt, verliert durch Anrechnung von Einkommen und Sozialleistungen oft einen Großteil des Zuverdienstes. Diese sogenannte Transferentzugsrate blockiert Anreize für Mehrarbeit – ein Problem, das selbst innerhalb der Ampel-Koalition erkannt wurde, aber bislang ungelöst blieb.
Robert Habeck war einer der wenigen Grünen-Politiker, die offen für eine Reform plädierten. Eine Anpassung der Transferentzugsrate könnte Menschen dazu motivieren, wieder in Vollzeitjobs einzusteigen, ohne dass sie durch übermäßige Anrechnung von Einkommen demotiviert werden. Doch eine solche Reform wäre kompliziert und müsste in ein größeres Sozialstaatskonzept eingebettet werden – ein Kraftakt, für den in Berlin derzeit wenig politischer Wille existiert.
Das könnte Sie auch interessieren: