Der Moment ist da – und er ist verdammt teuer
Straßen, die bröckeln. Schulen, die verfallen. Krankenhäuser, die aus der Zeit gefallen sind. Die Bundesrepublik steht vor einer historischen Weggabelung – und diesmal geht es nicht nur um politische Rhetorik, sondern um einen schlichten Fakt: Es ist Geld da.
Viel Geld. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist nicht der Mangel das Problem, sondern die Fähigkeit, überhaupt zu handeln.
500 Milliarden Euro hat die neue Bundesregierung unter CDU-Kanzler Friedrich Merz als Sondervermögen beschlossen. Zusätzlich fließen 100 Milliarden direkt an die Kommunen. In Summe will der Staat eine Billion Euro mobilisieren – verteilt auf mehrere Jahre, verteilt auf zahllose Baustellen. Die Hoffnung: Sanierung, Modernisierung, Aufbruch.
Die Sorge: Dass das Geld versickert. Dass der Staat wieder scheitert – an sich selbst.
Wenn Geld allein nicht reicht
Roman Preis, Kämmerer im niederbayerischen Straubing, kennt das Problem. Seit Jahren jongliert er mit einem kommunalen Haushalt, in dem Wünsche und Wirklichkeit kaum mehr zusammenpassen. Steigende Sozialausgaben, Tarifsteigerungen, Investitionsstau.

Die Folge: Projekte werden kleingehackt, Aula gestrichen, Schulerweiterung vertagt. Jetzt, mit den Berlin-Milliarden in Sicht, schöpft Preis neue Hoffnung – aber auch Zweifel:
„Wir brauchen nicht nur Geld. Wir brauchen Verlässlichkeit.“
Denn wer das System kennt, weiß: Deutschlands eigentliche Schwäche liegt nicht im Finanzierungsvolumen, sondern in seiner Struktur. In der föderalen Kakophonie zwischen Bund, Ländern und Kommunen. In der Bürokratie, die jedes Projekt in ein Labyrinth aus Zuständigkeiten, Verfahren und Verordnungen schickt. Und in einer Kultur des Misstrauens, in der Kontrolle über Handlung steht.
Investitionslücke: 900 Milliarden Euro – mindestens
Laut PwC fehlen dem Land 900 Milliarden Euro, um den Sanierungsstau aufzulösen. Das betrifft nicht nur Brücken oder Bahnstrecken, sondern auch Stromnetze, Kasernen, digitale Infrastruktur.
Doch das eigentliche Problem ist tiefer: Selbst bereitgestelltes Geld wird nicht abgerufen. Vom Digitalpakt Schule sind nach sechs Jahren gerade einmal die Hälfte der Mittel abgeflossen. Bei der Bundeswehr wurden bislang nur knapp 24 von 100 Milliarden Euro ausgegeben. Selbst der KI-Fördertopf wird kaum genutzt.
Die Ursache: zu kompliziert, zu kleinteilig, zu langsam.
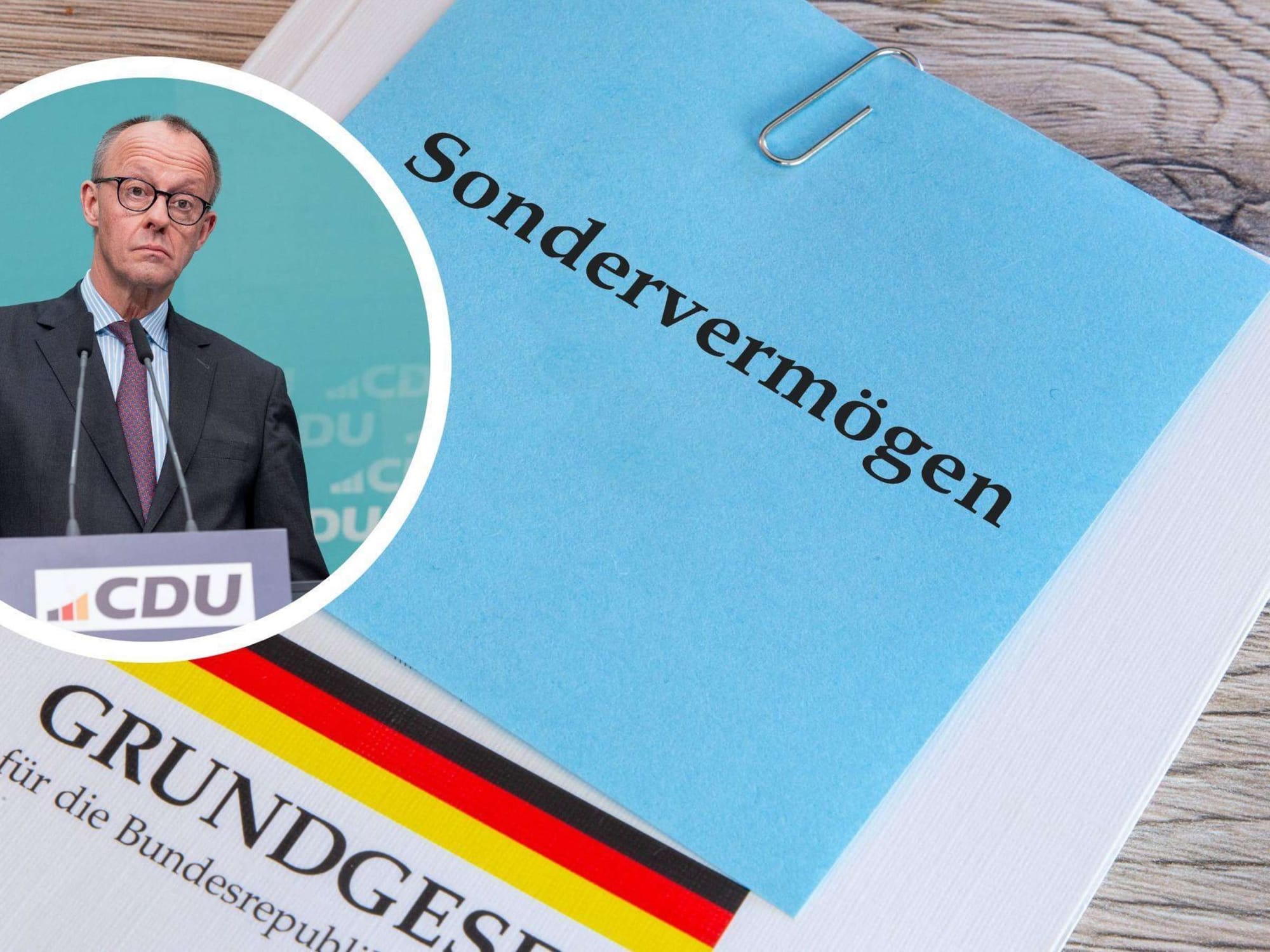
Die Haribo-Tüte der Politik
Ein Beispiel für das drohende Chaos liefert der ÖPNV. Anna-Theresa Korbutt, Chefin des Hamburger Verkehrsverbundes, sieht bereits den Verteilungskampf beginnen – zwischen Bahn, Verkehrsverbünden und Landesministerien.
„Es ist wie mit der Haribo-Tüte, die herumgereicht wird – einer zieht den Zonk.“
Statt koordiniert zu handeln, verhandeln in Berlin schon mal 140 Vertreter gleichzeitig über Ticketstrukturen. Ein föderales Symptom, das jede Planung lähmt.
Auch in der Praxis droht die Realität, jede Euphorie zu kontern: Ein Ersatzbau für eine einsturzgefährdete Brücke in Dresden soll – mit Glück – bis 2027 beginnen. Obwohl alle dafür sind. Obwohl Geld da ist. Weil trotz neuer Gesetze niemand genau sagen kann, was erlaubt ist und was nicht.
Billionenschance – aber mit Strukturdefizit
Friedrich Merz spricht vom „Whatever it takes“ für Deutschland. Doch was bleibt davon, wenn keine Reform folgt? Ein Sondervermögen ohne Planungsreform ist wie ein Supersportwagen mit leerem Tank.
Der Wille zur Beschleunigung ist formuliert – ob er auch umgesetzt wird, ist offen. Der Planungspakt der Ampelregierung stockte. 76 Milliarden Euro lagen zuletzt ungenutzt in öffentlichen Haushalten. Totkapital. Und der Nachschub kommt nun mit Macht.
Die Warnung der Bundesländer ist eindeutig: Ohne eine Reform der Verwaltung, ohne klare Prioritäten, ohne effizientere Verfahren droht der größte Investitionsschub in der Geschichte der Bundesrepublik zu verpuffen.
Wohin mit dem Geld?
Schon jetzt ist klar: Das Sondervermögen reicht nicht. Die Deutsche Bahn allein meldet 290 Milliarden Euro Bedarf an. Auch die Rüstungsindustrie fordert zweistellige Milliardenbeträge – mit der Aussicht auf technologische Hebelwirkung.
Jeder Euro, der dort investiert wird, könnte laut EY-Studie bis zu 1,94 Euro volkswirtschaftlichen Effekt entfalten. Verteidigung, Hightech, Forschung – es sind diese Felder, die mehr als nur Substanz erhalten. Sie schaffen neue.
Die eigentliche Kunst liegt also nicht im Ausgeben, sondern im Priorisieren.
Und was, wenn es nicht klappt?
Das Risiko ist real: Wenn Berlin, Hamburg, Dresden oder Hildesheim nicht liefern können – wenn das berühmte Deutschlandtempo wieder im Rückspiegel verschwindet – dann wächst aus Hoffnung Frust.
Und aus Investitionen Schulden ohne Wirkung. Lars Feld, ehemaliger Wirtschaftsweiser, bringt es auf den Punkt: „Wenn es keine Deregulierung gibt, keine Effizienz, dann bleibt nur das Defizit.“
Es wäre die größte vertane Chance in der Geschichte der Bundesrepublik.
Eine Billion ist kein Selbstläufer
Geld allein wird dieses Land nicht retten. Es braucht Geschwindigkeit, Mut, Struktur – und eine neue Haltung zum Staat. Vertrauen statt Kontrolle. Planung statt Blockade. Klarheit statt Bürokratiewirrwarr.
Die Billion ist nicht das Ziel. Sie ist der Hebel.
Die Frage ist: Wer nutzt ihn – und wer bricht daran?
