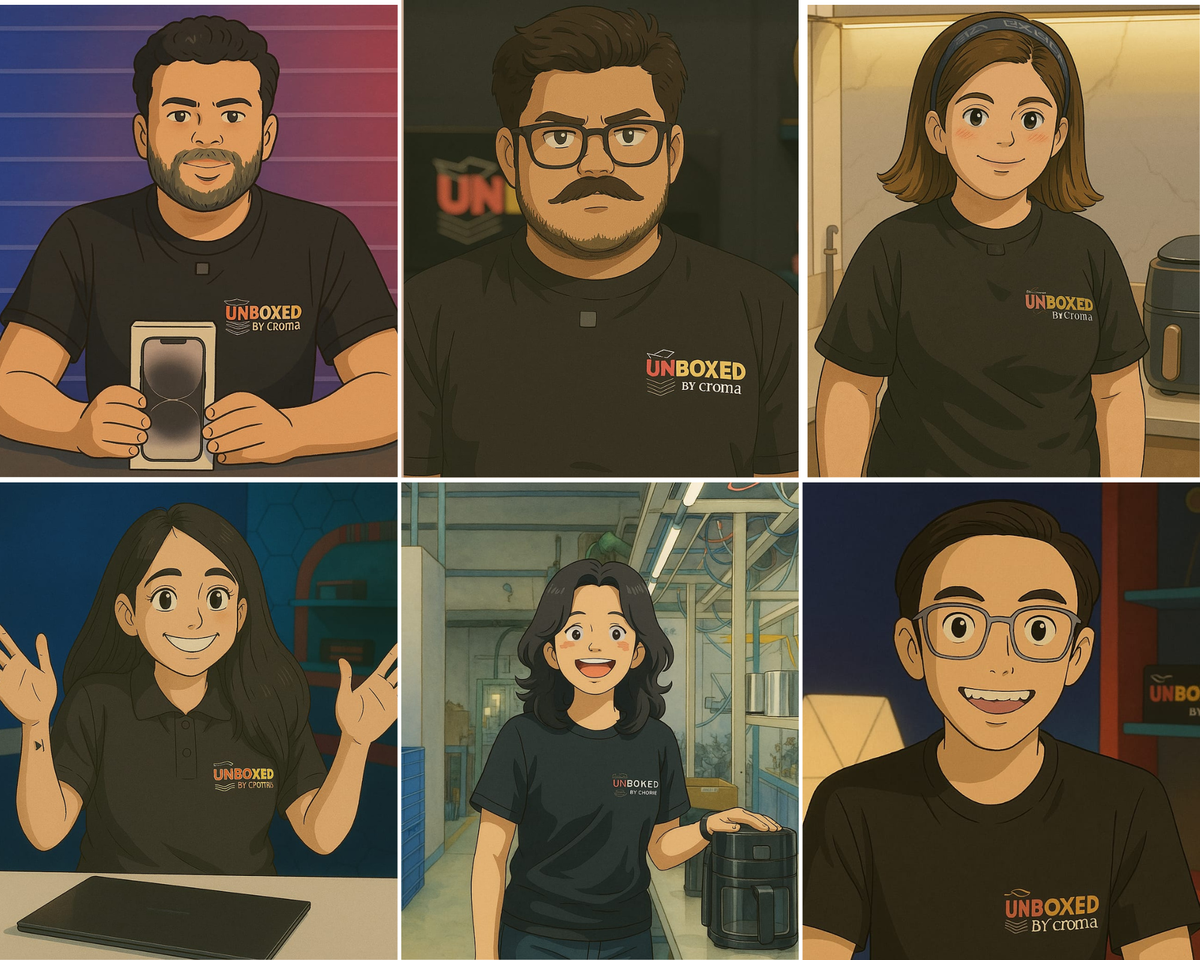Die Zahl, die alles verändert
Es ist eine dieser Zahlen, bei der selbst abgebrühte Haushälter schlucken: 350 Milliarden Euro. So viel zusätzliches Geld wollen CDU/CSU und SPD in der kommenden Legislatur offenbar locker machen – on top zu bestehenden Etats, Sondervermögen und Militärausgaben. Und das in Zeiten knapper Kassen und Schuldenbremse.
Wer dachte, Koalitionsverhandlungen liefen leise und vorsichtig, irrt. Das Papier der Arbeitsgruppen, das nun durchgestochen wurde, liest sich wie eine Wunschliste – oder wie der Entwurf für ein ambitioniertes, extrem teures Regierungsprogramm. Die Eckpunkte: Mehr Geld für fast alles, was chronisch unterfinanziert ist.
Gesundheitsausgaben: Der dickste Brocken
86 Milliarden Euro sollen allein in den Gesundheitsbereich fließen – für Kliniken, Pflege, Digitalisierung. Ein politisches Signal, sicher.
Aber auch ein Eingeständnis: Das System ist in einem Zustand, der Investitionen nicht nur rechtfertigt, sondern erzwingt. Was fehlt: Details. Wo genau das Geld hinfließen soll, welche Reformen es flankieren – unklar.

Bahn, Beton, Bildung – alles dabei
Fast schon erwartbar: Auch die Deutsche Bahn soll einen kräftigen Schluck aus der Pulle bekommen – 40 Milliarden Euro sind für Sanierung und Leitungsausbau eingeplant.
Die Gebäudesanierung kommt mit 55 Milliarden daher, der soziale Wohnungsbau mit 20 Milliarden, private Neubauten mit weiteren 9 Milliarden. Dazu: 30 Milliarden Euro fürs Elterngeld, 33 Milliarden für kostenlose Mittagessen an Schulen und Kitas.
Man könnte sagen: Es ist der große Wurf. Man könnte auch sagen: Ein Koalitionspapier als Katalog.
Wer soll das bezahlen?
Die zentrale Frage – keine Antwort. Bisher jedenfalls nicht. Die Schuldenbremse steht. Die Steuereinnahmen stagnieren. Neue Einnahmequellen? Fehlanzeige. Auch an der Steuerfront ist bislang alles ruhig. Weder Vermögensteuer noch Erhöhung des Spitzensteuersatzes sind offiziell im Gespräch. Damit wird klar: Die Finanzierung ist das ungelöste Rätsel dieser Pläne.
Union und SPD schweigen sich aus. CDU-Chef Friedrich Merz pocht öffentlich auf Haushaltsdisziplin, SPD-Chef Lars Klingbeil wirbt für Investitionen in die Zukunft. Zwei Haltungen, die in der Theorie kompatibel wirken, in der Praxis aber schwer zu vereinen sind.
Politik auf Pump?
Die Gefahr liegt auf der Hand: Ein Teil dieser Ausgaben könnte über Tricks am Rande der Schuldenbremse finanziert werden – neue Sondervermögen, kreative Haushaltskonstrukte, Abschreibungsmodelle. All das hat man schon einmal gesehen. Die Frage ist, wie lange sich diese Strategie noch durchhalten lässt, ohne dass das Vertrauen in die deutsche Finanzpolitik Schaden nimmt.
Viel Konsens, wenig Strategie
Was auffällt: Die geplanten Ausgaben decken ein breites Spektrum ab. Fast jede Wählergruppe bekommt etwas – Familien, Pflegekräfte, Mieter, Pendler, Schüler. Politisch clever. Aber eben auch riskant. Denn ohne Priorisierung wird am Ende alles ein bisschen, aber nichts richtig umgesetzt.
Das Papier wirkt in weiten Teilen wie ein Kompromissdokument. Man hat zusammengetragen, was jeweils als notwendig galt – ohne echte Abwägung, ohne Plan B. Es ist Konsenspolitik auf hohem Preisniveau.
Die Märkte schauen zu
Solche Zahlen bleiben nicht unbeachtet. An den Kapitalmärkten schaut man genau hin, wie ernst es Deutschland mit seiner Haushaltsdisziplin noch ist. Die Debatte um die Schuldenbremse, der Streit um das Klima-Sondervermögen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts – all das ist noch frisch. Sollte diese neue Koalition mit einem 350-Milliarden-Wunschpaket starten, dürfte das Vertrauen der Finanzmärkte auf die Probe gestellt werden.
Zwischen Realität und Rhetorik
Es wäre falsch, die Vorhaben pauschal zu verwerfen. Viele der geplanten Ausgaben sind notwendig, manche überfällig. Aber es fehlt die politische Ehrlichkeit. Wer investieren will, muss sagen, woher das Geld kommen soll. Wer sparen will, muss sagen, worauf verzichtet werden kann.
Beides geschieht bisher nicht.
Das könnte Sie auch interessieren: